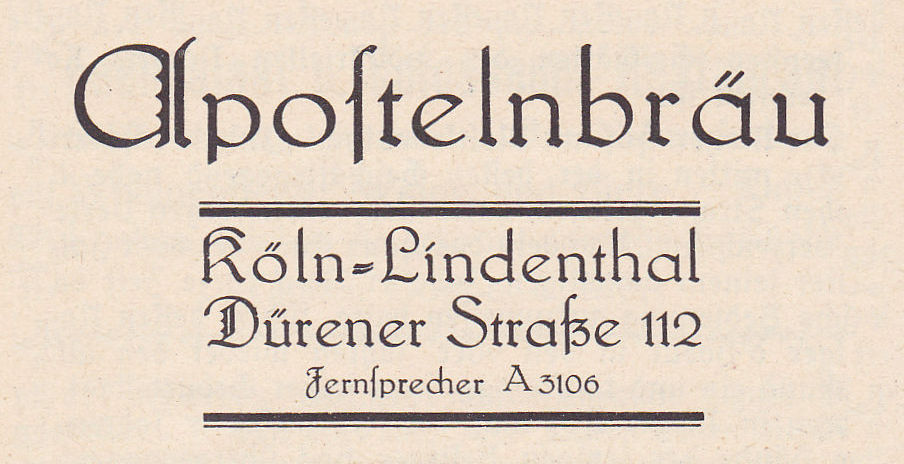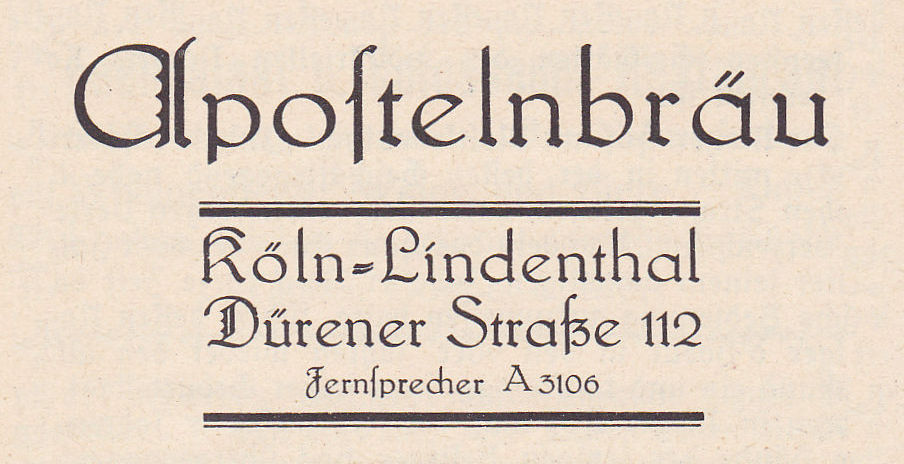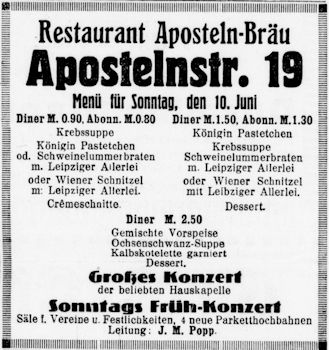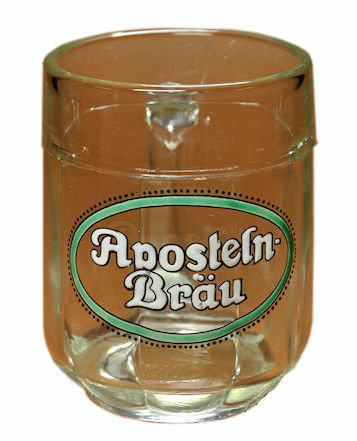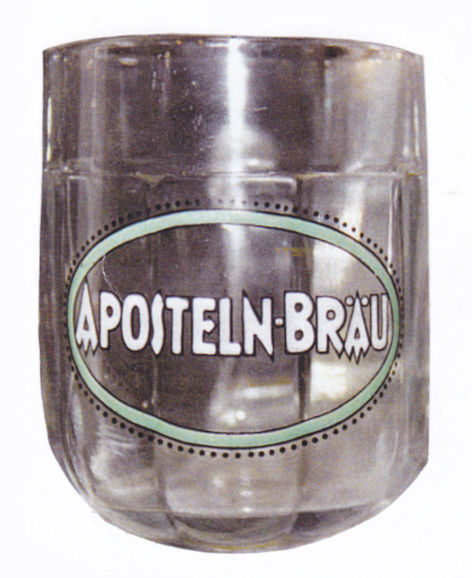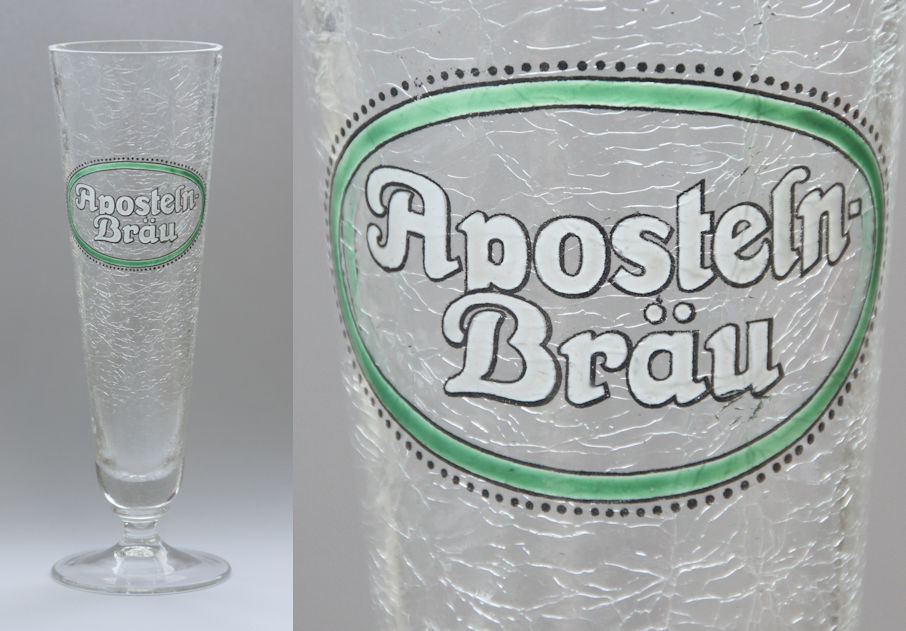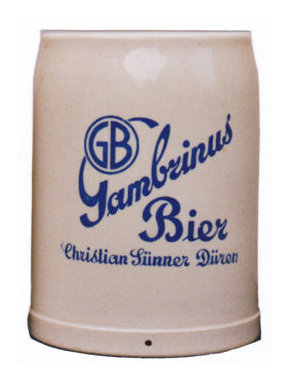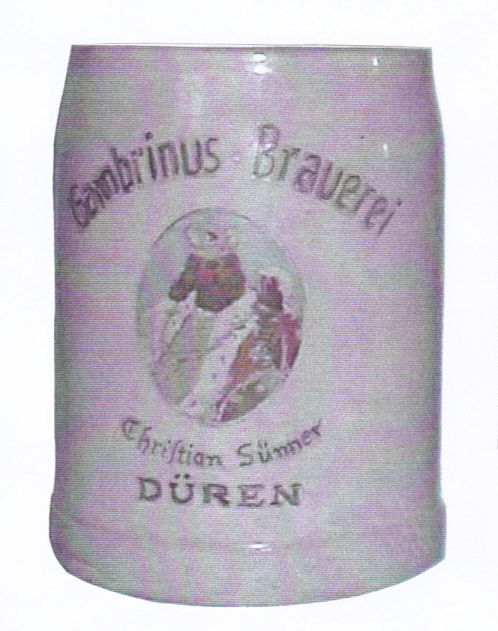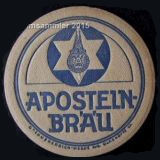Unternehmensgeschichte des Aposteln-Bräu
Heinrich Baedorf und der Westmark-Brauerei
Die Gründung des Apostelnbräu durch Peter Joseph Früh
Peter Joseph Früh, der Gründer des „Aposteln-Bräu“, wurde am 27.01.1862 als ältestes von 16 Kindern des Braumeisters Matthias Früh (1832-1885) und dessen Ehefrau Maria Sybilla Harff (1837-1882) in Brühl geboren.
Sein Vater besaß bereits eine Brauerei in Brühl.
In Köln tritt Peter Joseph Früh erstmals in Greven’s Adressbuch von 1890 in Erscheinung. Dort ist er als „P.J. Früh, Braumeister, Müngersdorf, Aachenerstr. 28“ geführt. Ein Jahr später wird er weiterhin als Braumeister, allerdings mit neuer Adresse, der Aachenerstraße 748-750 geführt. Diese Adresse ist keine Unbekannte, sondern die Adresse der „Brauerei C. Schmitz“ aus Müngersdorf (eine der 3 Gründungsbrauereien der Union-Brauerei, später Hubertus Brauerei). Es darf also angenommen werden, dass Peter Josef Früh seit 1890 Braumeister in der Schmitz’schen Brauerei war und von 1891 bis 1894 auch dort wohnte.
Im Jahr 1895 macht sich Peter Josef Früh dann in der Apostelnstraße 19 selbstständig und gründete die Hausbrauerei „Apostel-Bräu“. Das Haus in der Apostelnstraße 19 gehörte dem Fabrikbesitzer Wilhelm Anton Hospelt, der in Köln-Ehrenfeld eine chemische Fabrik betrieb. Dieser wohnte auch bis 1893 in diesem Haus, seit 1895 wird aber Peter Josef Früh auch als Eigentümer angegeben.
Beginnend im Jahr 1894 wurde das Haus zu einer Hausbrauerei umgebaut, es war also eine Neugründung und keine Übernahme einer bestehenden Brauerei.
Die Eröffnung der Brauerei verzögerte sich mehrfach. Der notwendige Dampfkessel war zwar genehmigt, die Ausschankkonzession wurde aber mehrfach mit der Begründung des „fehlenden Bedarfs“ verweigert.
Es bestand anscheinend aber doch Bedarf, die Hausbrauerei kam sehr gut an machte Peter Josef Früh
innerhalb weniger Jahre zu einem angesehenen und wohlhabenden Bürger Kölns.
 |
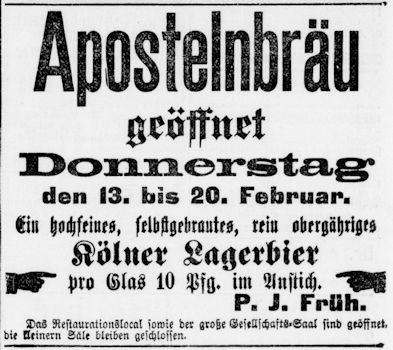 |
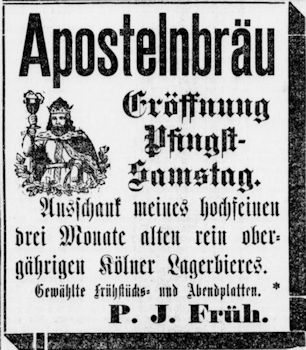 |
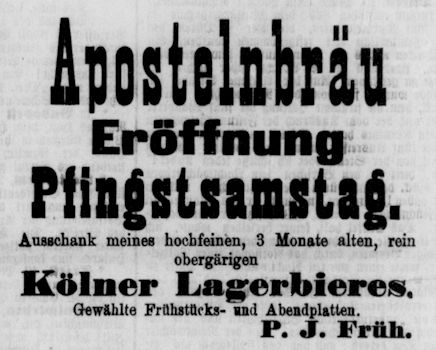 |
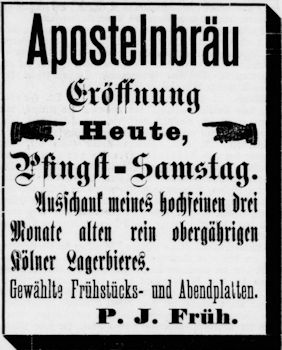 |
(W001) [unbekannt]
Werbeanzeige zur Eröffnung des Apostelnbräu
im Jahr 1895.
"Heute beginnt der Verkauf meines selbstgebrauten reinobergärigem Kölner Lagerbieres
zum Preis von à Liter 20 Pfg.
|
(W019) [20, 13.02.1895]
Anzeige des Apostelnbräu unter P.J. Früh aus dem Jahr 1896 |
(W020) [20, 20.05.1896]
Eröffnung? Anzeige des Apostelnbräu unter P.J. Früh aus MAi 1896 |
(W020) [22, 21.05.1896]
Eröffnung? Anzeige des Apostelnbräu unter P.J. Früh aus MAi 1896 |
(W021) [23, 21.05.1896]
Eröffnung? Anzeige des Apostelnbräu unter P.J. Früh aus MAi 1896 |
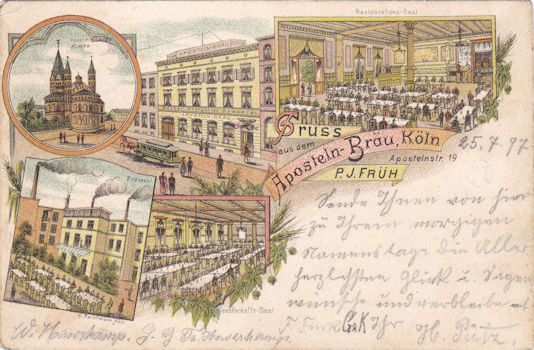 |
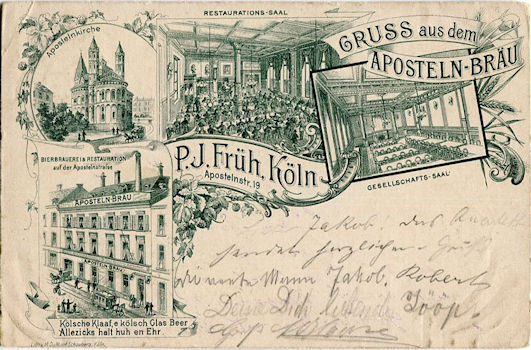 |
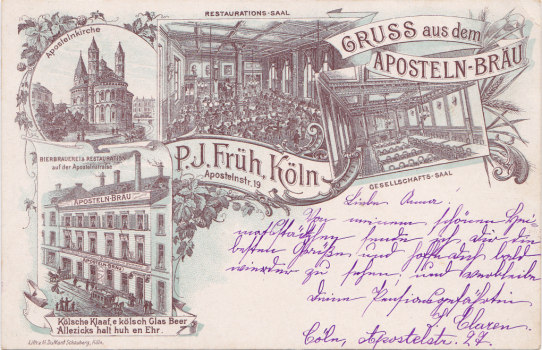 |
(PK008)
Postkarte des Apostelnbräu, noch unter P.J. Früh, gelaufen 1897. Die
Brauerei (unten links) ist noch in der Apostelnstraße, die Schornsteine
rauchen noch |
(PK005) [unbekannt]
Postkarte des Apostelnbräu, noch unter P.J. Früh (1895-1898). |
(PK010)
Farbvariante der links stehenden Postkarte |
Die Ära Baedorf und die Verlagerung der Brauerei nach Köln-Lindenthal
Bereits 1898, d.h. nur 3 Jahre nach der Gründung, verkaufte Peter Josef Früh die florierende Hausbrauerei an Heinrich Baedorf weiter (manchmal mit „ä“, manchmal mit „ae“ geschrieben). Die Gründe hierfür sind nicht bekannt, vielleicht wollte er einfach den in kurzer Zeit erreichten Wohlstand genießen. Nach 6 Jahren Auszeit als Privatier gründete Peter Josef Früh dann aber im Jahr 1904 das „Cölner Hofbräu P. Josef Früh“, welches heute noch als eine der bekanntesten und erfolgreichsten Kölsch-Brauereien existiert.
Über Heinrich Baedorf ist wenig bekannt. In Brauereiregistern
taucht er von 1884 bis 1892 als Besitzer der Brauerei "Im Anker" in der
Zollstraße 17 auf.
Auch unter Heinrich Baedorf floriert das Aposteln-Bräu weiter.
Im Jahr 1900 starb Heinrich Baedorf völlig überraschend im Alter von nur 43
Jahren und die Brauerei
wurde von seiner Witwe übernommen, welche die Führung der Brauerei an Peter
Schmitz übertrug. Peter Schmitz war ein erfahrener Brauer, er war zuvor 16
Jahre als Braumeister in der städtischen Brauerei im Alexianerkloster tätig
gewesen. Die Brauerei selbst wurde nur 11 Tage nach dem Tod an Louis Berg
verkauft:
[14, 01.05.1900] Köln. In das Handelsregister des unterzeichneten
Amtsgericht ist eingetragen: Am 18. April 1900 unter Nr. 155 die Firma:
Apostelnbräu, Heinr. Baedorf, Köln, ist auf Louis Berg, Kaufmann zu Köln,
übertragen worden. Der Uebergang der in dem Betriebe des Geschäfts
begründeten Forderungen, welche nicht durch Eintragung in die
Gesellschaftsbücher bis zum 6. April 1900 ersichtlich sind, ist bei dem
Erwerbe des Geschäfts durch Louis Berg ausgeschlossen.
Die Räumlichkeiten wurden wohl für Gastraum und Brauerei
gleichzeitig zu eng und so wurde die Brauerei im Jahr 1902 die Brauerei nach Köln Lindenthal
in die Dürenerstraße 112 verlagert.
Die Brauerei in der Dürenerstraße 112
war kein Neubau, vorher war hier das „Brauhaus Servatius Krings“ bzw. die „Brauerei Geschw. Krings“, welches aber schon 1898 geschlossen wurde. Heinrich Baedorf hatte diese Brauerei bereits 1899 erworben. Platz war hier genug, es wird von großen Kellereien und großzügigen Gartenanlagen berichtet. Der Umzug in die Dürenerstraße ist auch
gut an 2 weiter unten abgebildeten Postkarten zu erkennen. Auf PK005, noch unter Peter Josef Früh, ist das Gebäude in der Apostelnstraße 19 oben links mit rauchenden Schornsteinen abgebildet, damals noch ein Indikator für Modernität und Fortschritt. Auf PK004, schon unter Heinrich Baedorf, vermutlich um
1903, ist oben rechts das gleiche Gebäude in der Apostelnstraße 19 zu sehen, allerdings sind die Schornsteine verschwunden. Zusätzlich ist unten links die Brauerei in der Dürener Straße zu sehen, natürlich mit rauchenden Schornsteinen. Der Titel der Brauerei lautet „Brauerei u. Garten“, es gab also auch in der Dürener Straße eine Restauration.
Betrieben wird das Aposteln-Bräu ab ca. 1901 von Carl Kirsch, der auch als Inhaber genannt wird. Ab dem Jahr
1911 wird Carl Kirsch auch als Besitzer geführt.
Die Umstände und die Beziehung zwischen Heinrich Baedorf und Louis Berg sind mir leider nicht bekannt. Ungewöhnlich ist, dass sich die Firmierung nach außen hin nicht ändert, die Brauerei
hieß weiterhin „Aposteln-Bräu Heinrich Baedorf“, Louis Berg wurde nur als Inhaber genannt. Der Name „Heinrich Baedorf“
wurde bis 1934 weitergeführt.
Louis (eigentlich Ludwig) Berg, war bereits ein erfolgreicher und wohlhabender Geschäftsmann. Ihm gehörten u.a. 50% an dem von seinen Großeltern gegründeten Bankhauses „S. Hanf“ und eine Zeche.
Auch sein Sohn Eduard Berg war in der Brauerei tätig, seit 1908 als
Prokurist [14].In einem Brauereiverzeichnis aus dem Jahr 1910 [9] ist zu lesen, dass Louis Berg bereits seit 1898 Besitzer der Brauerei wäre, was der Darstellung widerspricht, dass Heinrich Baedorf der zwischenzeitliche Besitzer gewesen wäre. Möglich wäre aber auch, dass Heinrich Baedorf und Louis Berg schon länger geschäftliche Beziehungen hatten.
Die Brauerei ist zu dieser Zeit modern mit Dampf- und
Eismaschine ausgestattet. Sie verfügt über 3 „Spezialausschankstellen“ (in
der Apostelnstraße, in der Schildergasse und in der Hohe Pforte). Die
Restauration in der Hohe Pforte war das ehemalige Brauhaus Lölgen, dass zu
dieser Zeit den Brauereibetrieb bereits eingestellt hatte. Zusätzlich wird
das Bier auch in Flaschen verkauft.
Im Jahr 1912 wird die Firma in eine offene Handelsgesellschaft
umgewandelt und, der Sohn von Louis Berg, Eduard Berg, tritt als persönlich
haftender Gesellschafter in die Firma ein [14]. Die Brauerei firmiert fortan
als „Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Louis & Eduard Berg“ auf.
Im Jahr 1925 scheidet Louis Berg aus der Führung der Brauerei aus
[14] und ein weiterer Sohn, Rudolf Berg, steigt in die Firma ein . Die Firmierung lautet bis 1934 „Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Eduard &
Rudolf Berg“.
In seinen Beschreibungen der Kölner Kneipen aus dem Jahr 1921
beschreibt der Kölner Chronist Lambert Macherey die Brauerei wie folgt [12]:
An der Dürener Straße in Köln-Lindenthal befindet sich seit einigen Jahren
das Apostelnbräu in den Gebäulichkeiten des ehemaligen Kölner Brauhauses
Servatius Krings, der seine Brauerei von der Ehrenstraße in den 80er Jahren
nach seinen in Lindenthal befindlichen Kellereien mit schönen Gartenanlage
verlegt hatte, während das vom Brauere Bädorf gegründete Apostelnbräu an der
Apostelnstraße lag, wo sich heute noch der Hauptausschank in dem stattlichen
Neubau befindet. Vor mehreren Jahren ging das Apostelnbräu in die Hände der
jetzigen Besitzer über, die das ehemals Kringsche Anwesen in Lindenthal
nebst Brauerei erwarben.
In einer Sonderbeilage des Kölner Tageblattes vom 15. Dezember 1929 wird die Brauerei wie folgt beschrieben
[4]:
In Lindenthal, an der Dürener Straße 112, liegt das Apostelnbräu in den Gebäulichkeiten des ehemaligen Kölner Brauhauses Servatius Krings, der seine Brauerei in den 80er Jahren von der Ehrenstraße nach seinen in Lindenthal liegenden Kellereien mit schönen Gartenanlagen verlegt hatte. Das vom Brauer Bädorf gegründete und einst von Kirch geführte Stammhaus liegt an der Apostelnstraße und ist heute noch der Hauptausschank der Brauerei, deren Besitzer heute R. Berg ist. Einen anderen Ausschank hat sie in dem schönen Barockhaus "Zur Meerkatz", später Schallenberg-Sistig, in der Matthiasstraße 21, errichtet.
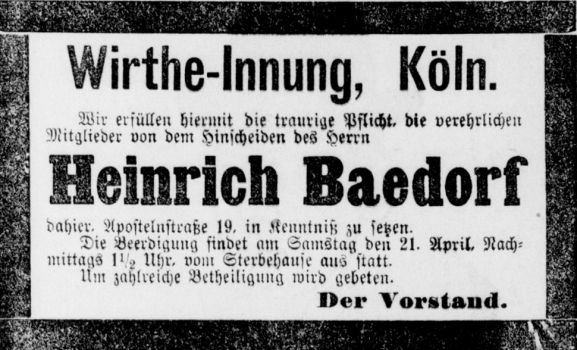 |
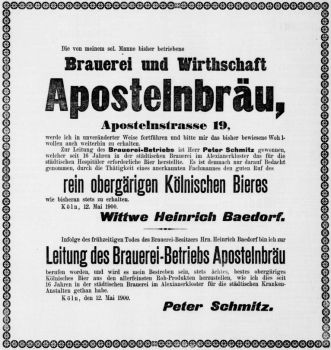 |
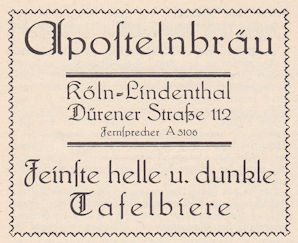 |
(WPE002) [17, 20.04.1900]
Todesanzeige von Heinrich Baedorf, welcher am 20.04.1900 im Alter von nur 43
Jahren verstarb |
(W007) [17, 05.12.1900]
Ganzseitige Anzeige von Witwe Baedorf aus dem Jahr 1900, in welcher sie die
Leitung der Brauerei nach dem Tod ihres Ehemanns Heinrich Baedorf an Peter
Schmitz überträgt |
(W002)
[12]
Werbeanzeige des Apostelnbräu aus dem Jahr 1921
|
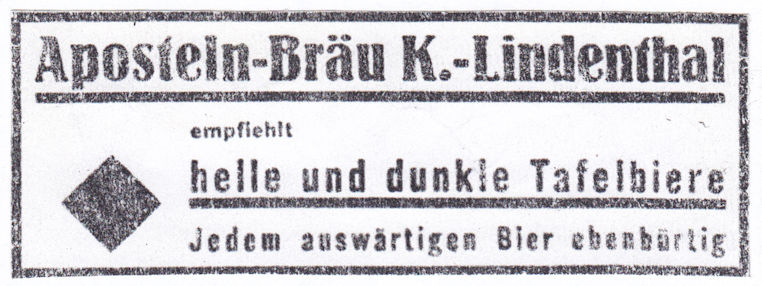 |
 |
 |
(W003)
Werbeanzeige des Apostelmbräu
(unbekannte Sammlung)
|
(F001) [unbekannt]
Foto mit Passanten, im Hintergrund eine Restauration mit "Aposteln-Bräu".
Vermutlich ein Ausschank in der Innenstatt, definitiv nicht Apostelnstraße
oder Dürenerstraße
|
(W010) [19]
Foto der Brauerei in der Dürener Straße. Zu sehen ist die Brauerei, der
Biergarten und der Brauerei-Ausschank |
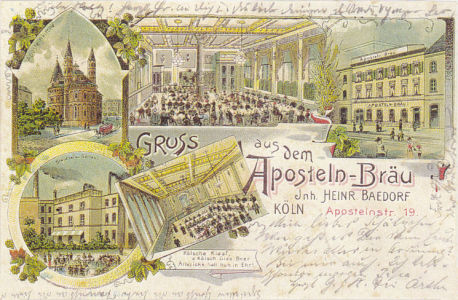 |
 |
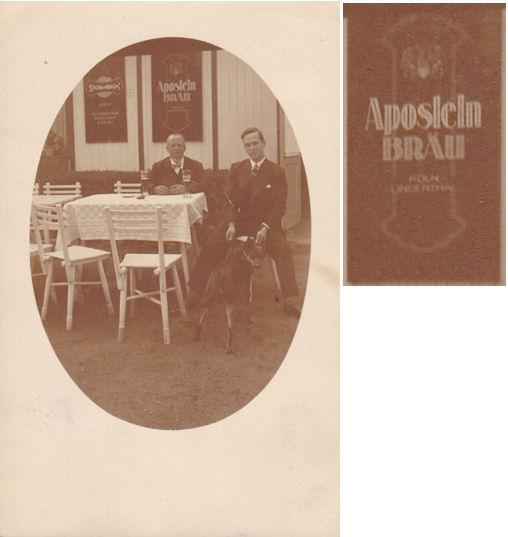 |
(PK004) [13]
Postkarte des Aposteln-Bräu unter Heinrich Baedorf, gelaufen 1900.
Die Schornsteine in der Apostelnstraße sind weg (oben rechts), stattdessen
ist zusätzlich die Brauerei in der Dürenerstraße in Köln-Lindenthal abgebildet (unten links,
"Brauerei & Garten")
|
(F001) [Sammlung Karin Bamberg]
Foto eines Lastwagens der "Speditions & Lagerhaus Aktien Gesellschaft" aus
Köln. In diesem Zusammenhang ist aber das Schild "Aposteln-Bräu" im
Hintergrund interessant. Der LKW parkt vor der Brauerei in der
Dürenerstraße. |
(PK001)
Fotopostkarte mit 2 Herren vor einer Restauration. Im Hintergrund ist ein "Aposteln-Bräu
Hinterglasschild zu sehen |
 |
 |
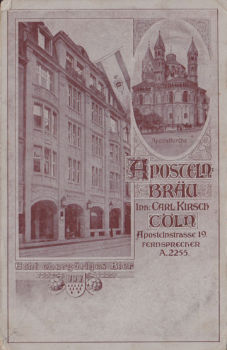 |
(PK007) [13]
Postkarte des Aposteln-Bräu, gelaufen 1908.
Inhaber ist schon Karl Kirsch |
(PK003) [unbekannt]
Postkarte des Aposteln-Bräu aus dem Jahr 1912.
Inhaber ist Karl Kirsch. Das Gebäude in der Apostelnstraße 19 ist
mittlerweile
komplett umgebaut und um einige Stockwerke vergrößert.
|
(AK003) [Sammlung Hildner]
Postkarte des Aposteln-Bräu aus dem Jahr 1913.
Inhaber der Restauration in der Apostelnstraße ist Karl Kirsch |
 |
 |
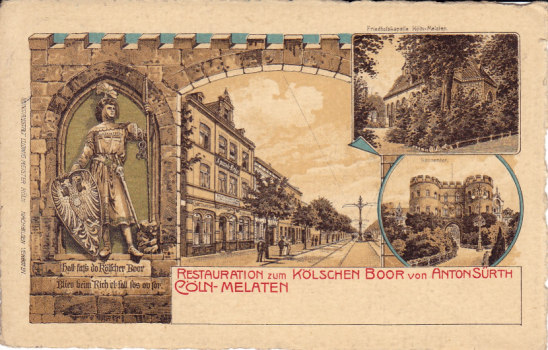 |
(PK011) [24, Sammlung Ippen]
Postkarte mit dem Innenraum des "Restaurant Apostelnbräu" unter Karl Kirsch.
Gelaufen 1912. |
(AK006) [unbekannt]
Postkarte des Aposteln-Bräu, vermutlich aus den 20er Jahren. Inhaber ist
nicht mehr Karl Kirsch sondern Wilhelm Reuther |
(PKB003) [24, Sammlung Ippen]
Postkarte des Kölschen Boor, gelaufen im Jahr 1916. Gut zu sehen ist die
Werbung für Aposteln Bräu. Es handelt sich hierbei um eine Postkarte der
Restauration "zum Kölschen Boor" von Anton Sürth auf der Aachener Straße und
nicht etwa eine Postkarte des Kölschen Boor am Eigelstein, welcher ja
eigenes Bier braute
|
 |
 |
|
(PK002)
Postkarte des Barbarossa Platzes mit Aposteln-Bräu Restauration im
Hintergrund |
(F003) [unbekannt ]
Ein Haufen Nazi-Schergen vor einer Kölner Wirtschaft mit Außenwerbung für "Aposteln-Bräu"
und "Höhenhaus Bier"
|
|
 |
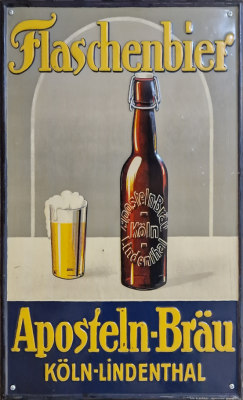 |
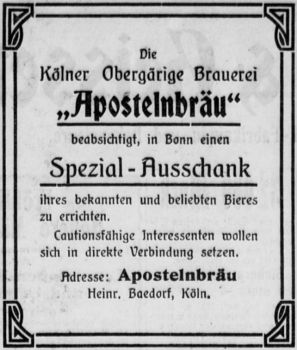 |
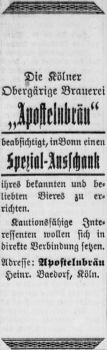 |
 |
(F001)
Foto des Aposteln-Bräu in der Apostelnstraße aus dem Jahr 1914
(unbekannte Sammlung) |
(W003) [Sammlung Mühlens]
Vermutlich ein Werbe-Schild des Aposteln-Bräu aus Blech
|
(W008) [18, 04.09.1906]
Expansionspläne des Apostelnbräu. In Anzeigen im Bonner Generalanzeiger
werden Bewerber für einen Spezial-Ausschank gesucht |
(W009) [18, 07.09.1906]
Weitere Suchanzeige des Apostelnbräu
|
(W012) [21, 15.01.1907]
Anfang des Jahres 1907 war mit dem Hotel "Zum Storch" eine Absatzstätte in
Bonn gefunden |
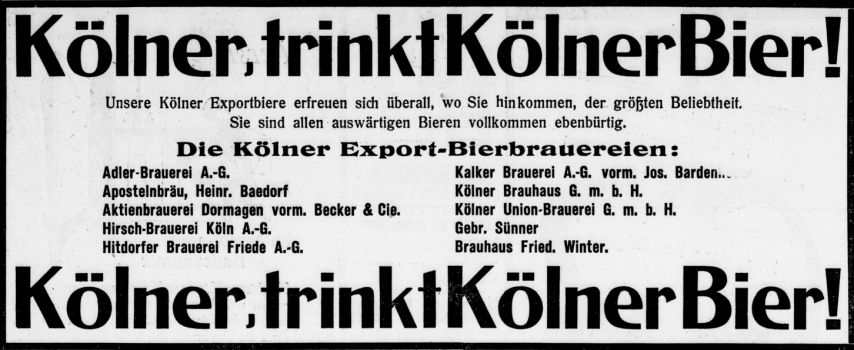 |
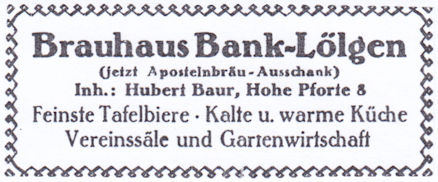 |
(106) [23, 13.05.1928]
Gemeinsame Anzeige der Kölner Großbrauereien aus dem Jahr 1928. Die
industriell untergärig brauenden Brauereien hatten mit der Konkurrenz
außerhalb von Köln, insbesondere der Dortmunder Brauereien zu kämpfen.
Deshalb appellierten sie an den Lokal-Patriotismus der Kölner |
(W005)
[12]
Werbung für die Spezialausschankstelle des Apostelnbräu in der Hohe Pforte
aus dem Jahr 1921.
Die Restauration war das ehemalige Brauhaus Lölgen, in dem nicht mehr selbst
gebraut wurde |
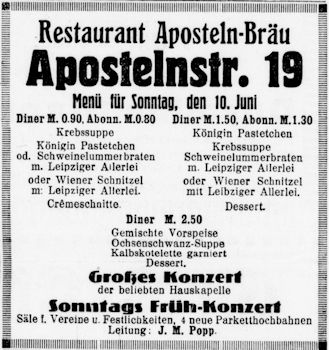 |
|
(W018) [20, 09.06.1928]
Anzeige des Restaurant Aposteln-Bräu aus dem Jahr 1928. Zu dieser Zeit unter
der Leitung von J.M. Popp |
|
Crhistian Sünner, die Westmark Brauerei
und das Ende
Am 19.03.1934 (mit Wirkung zum 01.01.1934) fusioniert die Brauerei dann mit der der Gambrinus-Brauerei Christian Sünner aus Düren und firmiert fortan als „Westmark-Brauerei Christian Sünner G. m. b. H.“. Christian Sünner taucht nicht nur alleinig in der Firmierung auf, er ist auch
Geschäftsführer der Brauerei. Von der Familie Berg ist keine Rede mehr. Der Hintergrund dieser Firmierung ist unklar. Es gibt Hinweise, dass die Familie Berg
auf Grund ihres jüdischen Glaubens aus der Brauerei gedrängt wurde, belegt ist das aber nicht. Louis Berg wird in Greven’s Adressbuch für Köln aus dem Jahr 1934 schon als Rentier geführt, er stirbt noch im selben Jahr (25.10.1934).
Formell wurde das Aposteln-Bräu erst am 5. Mai 1939 aufgelöst [14].
Der neue Besitzer, Christian Sünner, stammte aus der Brauer-Familie Sünner, die 1830
ihre Brautradition mit einer Brauerei in Deutz begründet hat und heute noch in Köln-Kalk die älteste noch existierende
Kölner Brauerei betreibt. Christian Sünner erwarb am 13.01.1931 die Traditionsbrauerei „Exportbierbrauerei Gambrinus Franz Althoven“ in Düren
[14]. Diese Brauerei wurde bereits 1870 gegründet und existierte seit 1885 auch unter der vorgenannten Firmierung. Im Rahmen der Fusionierung mit der Aposteln-Brauerei wurde die Braustätte in Düren stillgelegt und nur noch als Bierniederlage genutzt.
Die Umstände, welche zur Übernahme der Brauerei in Düren und dann zur Fusion mit dem Aposteln-Bräu führten, liegen im Dunkeln. Was nicht im Dunkeln liegt ist die Tatsache, dass die Westmark-Brauerei nicht besonders erfolgreich war. Gebraut wurde nur
über einen Zeitraum von 2 Jahren. In einem Brauereiverzeichnis aus dem Jahr 1934 liest sich das auf den ersten Blick noch
erfolgversprechender: Das Stammkapital beträgt 100 000 Reichsmark, Braumeister ist Fritz Wassmann. Es gibt Bierniederlagen: Aachen, Düren (Gambrinus-Brauerei), Eschweiler u. München-Gladbach. Die Brauerei verfügt über ein Sudwerk mit 50 Ztr. Schüttung, 2 Dampfmaschinen, 3 Eismaschinen, elektrische Eigenstromerzeugung sowie eine automatische Faß- u. Flaschenbieranlage. Produziert werden Unter- und Obergärige Biere.
Am 01.08.1936 wurde das Ende der Brauerei eingeleitet. An diesem Tag übernahm die Hirsch-Bräu AG aus Köln die Westmark-Brauerei als Beteiligung zu 100 %.
Christian Sünner verblieb zuerst in der Geschäftsführung, war aber nicht mehr
alleine Vertretungsberechtigt. Als weiterer Geschäftsführer wurde Emil Thümmler bestellt. [14]. Die Gesellschaft schloss ein Lohnbrauabkommen mit der Hirsch-Bräu A. G. geschlossen, in dessen Zuge die Brauerei in der Dürener Straße stillgelegt wurde.
Im Juni 1939 schied Christian Sünner als Geschäftsführer aus der
Gesellschaft aus [14]. Verarmt ist Christian Sünner hierdurch nicht, er war
u.a. in den 1940er Jahren noch Aufsichtratsmitglied der Hubertus-Brauerei
AG, Köln und wohnte im noblen Kölner Stadtteil Marienburg [14]. Formal wurde die
Gesellschaft erst 1950 aufgelöst.
 |
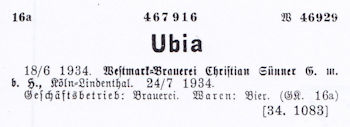 |
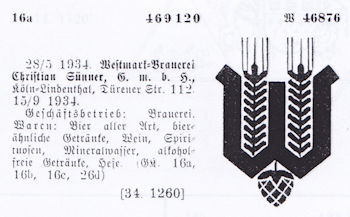 |
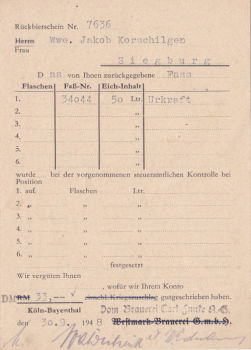 |
(W001)
Werbung für "Gambrinus Ur-Bräu" der Gambrinus-Brauere von Franz Althoven.
Hier ist Christian Sünner noch nicht genannt, wohl aber schon "Köln"
(unbekannte Sammlung)
|
(WZ001)
Warenzeichen "Ubia" der Westmark-Brauerei Christian Sünner G.m.b.H.
Eingetragen am 24.07.1934 |
(WZ001)
Warenzeichen (Bildmarke) der Westmark-Brauerei Christian Sünner G.m.b.H.
Eingetragen am 15.09.1934 |
(RB001)
Rückbierschein der Dom-Brauerei. Der Vordruck war ursprünglich für die
Westmark-Brauerei, sparsam wie man war, wurde alles überstempelt |
Firmierungen Aposteln-Bräu / Westmark-Brauerei:
[14,15]
|
Zeitraum |
Firmierung |
Anmerkung |
|
1895 – 1898 |
Brauerei Peter Jos. Früh, Aposteln-Bräu, Apostelnstraße 19 |
|
| 1898 – 1905 |
Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf |
|
| 1905 – 1912 |
Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Louis
Berg |
|
| 1912 – 1925 |
Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Louis
& Eduard Berg |
Ab 1912 offene Handelsgesellschaft |
| 1925 – 1934 |
Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf, Inh. Eduard
& Rudolf Berg |
Fusioniert mit der Gambrinus-Brauerei
aus Düren zur Westmark-Brauerei, erst 1939 formell aufgelöst |
| 1934 – 1936 |
Westmark-Brauerei Christian Sünner
G.m.b.H. |
100% Beteiligung der Hirsch-Bräu AG,
Köln |
| 1936 – 1950 |
Westmark-Brauerei G.m.b.H. |
|
Firmierungen Gambrinus-Brauerei, Düren:
|
Zeitraum |
Firmierung |
Anmerkung |
|
1870 – 1885 |
Brauerei Hubert Althoven |
|
| 1885 – 1931 |
Exportbierbrauerei Gambrinus Franz
Althoven |
Franz Althoven hat parallel von 1911 -
1928 das "Obergärige Brauhaus St. Peter" in Köln betrieben |
| 1931 – 1934 |
Gambrinus-Brauerei Christian Sünner |
Fusioniert 1934 mit der
Aposteln-Brauerei zur Westmark-Brauerei |
Anmerkungen
| » |
Das Haus in Apostelstraße 19 ist noch heute erhalten und beherbergt zurzeit ein Weinlokal und ein Modegeschäft |
| » |
Der Name Baedorf taucht noch im Zusammenhang mit anderen Brauereien auf. Zum einen bei einem Vorgänger der Brauerei „zum Prinz Eugenius. Von 1911-1913 heißt dies Brauerei „Brauerei Wwe. Heinr. Baedorf“. Zum anderen im Andreas Bräu, welches von 1918 bis 1920 als „Andreas Bräu Wwe. Heinr. Bädorf“ firmiert |
| » |
Die Familie Berg war jüdischen Glaubens. Ungesichert, aber nicht unwahrscheinlich ist, dass die Aufgabe der Brauerei 1934 nicht ganz freiwillig vonstattenging. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden Bürger jüdischen Glauben immer mehr drangsaliert und aus mussten ihre Geschäfte aufgeben. Ein Sohn von Eduard Berg nahm sich 1937 im Alter von 18 Jahren das Leben. Auch hier liegt ein Zusammenhang mit der Herrschaft der Nationalsozialisten nahe. Eine Tochter von Eduard Berg wurde im Alter von 19 Jahren in Auschwitz ermordet, weitere nahe Verwandte 1945 in Bergen-Belsen |
| » |
Gesichert für das Jahr 1901 war Johann Berresheim Geschäftsführer des Apostelnbräu. Johann Berresheim betrieb von 1906 bsi 1909 gemeinsam mit Amandus Graeff das Brauhaus "Im Kaiser" in der Ehrenstraße 74 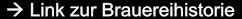 |
Gläser & Glaskrüge
Die Qualität der Abbildungen ist teilweise nicht besonders gut, das Augenmerk liegt hier auf der Vollständigkeit.
 |
 |
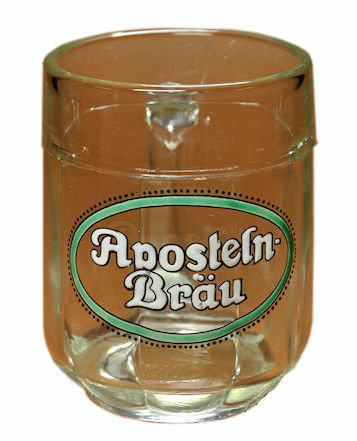 |
(GK004)
Aposteln-Bräu Pilsener, 6/20 L geeicht
(unbekannte Sammlung)
|
(GK001)
Aposteln-Bräu
(Sammlung Mühlens)
|
(GK002)
Aposteln-Bräu.
Vermutlich 5/20 L geeicht
(unbekannte Sammlung)
|
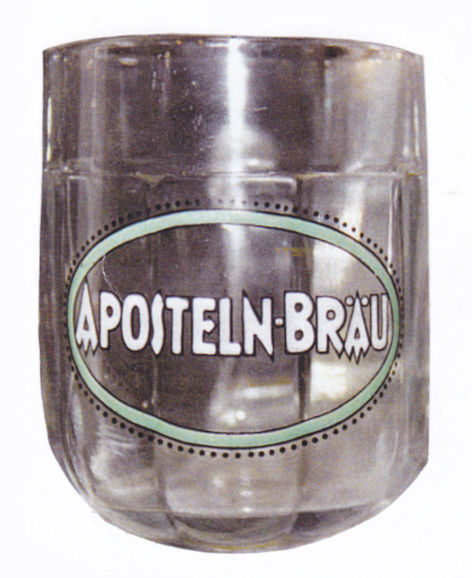 |
|
|
(Gk003)
Aposteln-Bräu,
5/20 L geeicht
(unbekannte Sammlung)
|
|
|
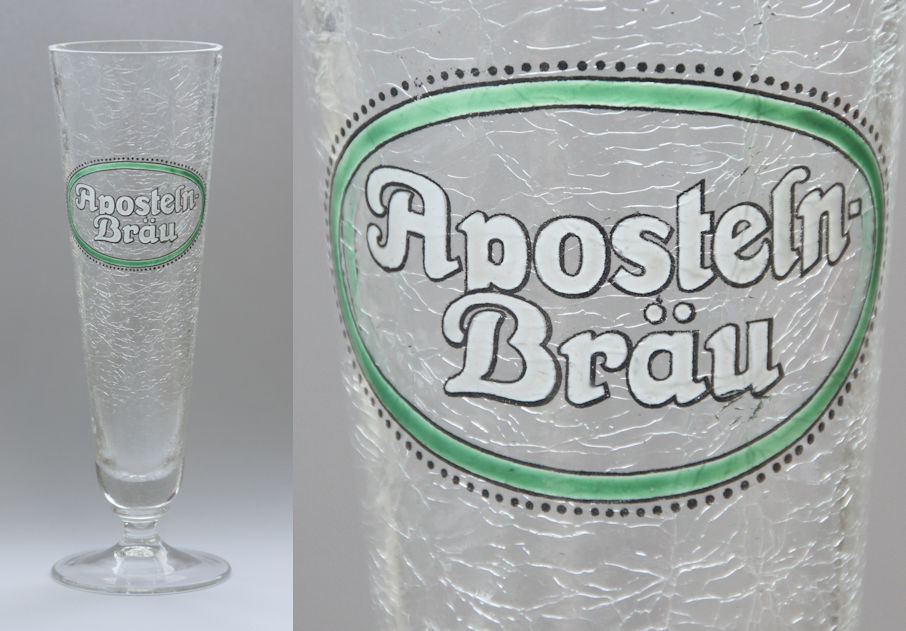 |
 |
 |
(G002)
Aposteln-Bräu, Crash-Flöte, 6/20 L geeicht
(Sammlung Mühlens)
|
(G003)
Aposteln-Bräu, 6/20 L geeicht
(unbekannte Sammlung) |
(G001)
Aposteln-Bräu Pilsener, 6/20 L geeicht
(unbekannte Sammlung) |
 |
|
|
(G001)
Westmark Brauerei Christian Sünner G.M.B.H.
5/20 L geeicht
(Sammlung Mühlens)
|
|
|
Tonkrüge
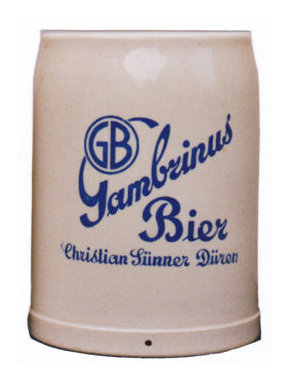 |
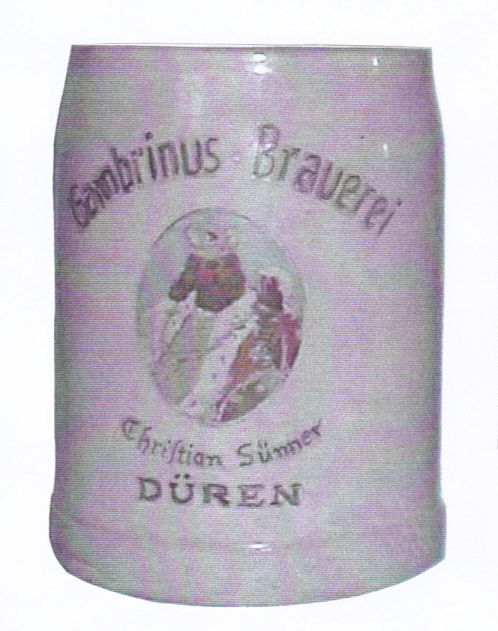 |
 |
|
(K001)
"Gambrinus Bier",
"Christian Sünner Düren"
Merkwürdigerweise ist hier nur Düren und nicht Köln genannt. Gibt es auch
mit Zinndeckel
(unbekannte Sammlung) |
(K003)
"Gambrinus Brauerei, "Christian Sünner", "Düren"
(unbekannte Sammlung) |
(KA002)
"St. Peter-Bräu", "Köln Düren".
Im Dreieck befinden sich die stilisierten Buchstaben "FA" für Franz Althoven,
von welchem Christian Sünner die Gambrinus Brauerei übernommen hatte
(unbekannte Sammlung) |
|
Bierdeckel
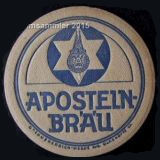 |
 |
 |
|
(001)
(unbekannte Sammlung) |
(003)
(unbekannte Sammlung)
|
|
|
 |
 |
|
|
(001)
"Gambrinus Brauerei" "Christian Sünner Düren".
1934 mit dem Aposteln-Bräu zur Westmark Brauerei fusioniert
(unbekannte Sammlung)
|
(002)
"Gambrinus Brauerei" "Christian Sünner Düren".
1934 mit dem Aposteln-Bräu zur Westmark Brauerei fusioniert
(unbekannte Sammlung) |
|
|
 |
 |
|
 |
(003)
"Gambrinus Brauerei" "Christian Sünner Düren".
1934 mit dem Aposteln-Bräu zur Westmark Brauerei fusioniert
(unbekannte Sammlung) |
(004)
"Gambrinus Brauerei" "Christian Sünner Düren".
1934 mit dem Aposteln-Bräu zur Westmark Brauerei fusioniert
(unbekannte Sammlung) |
|
(001)
"Westmark-Brauerei Christian Sünner G.m.b.H.".
1934 bis 1936, anschließend bis 1950 ohne eigene Produktion |
Prägeflaschen
 |
 |
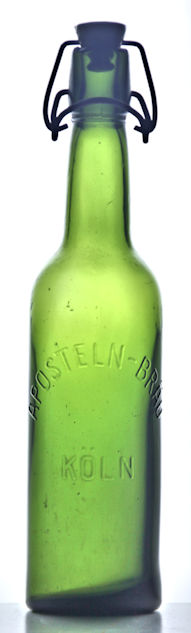 |
 |
 |
| (004) |
(1007) |
(222) |
(1056) |
(162) |
Aposteln-Bräu Köln-Lindenthal.
Ca. 0,4 l, gesandstrahlt
|
Aposteln-Bräu Köln
Ca. 0,4 l
(Sammlung Liesack)
|
Aposteln-Bräu Köln
Ca. 0,4 l
|
Gambrinus-Brauerei
Christiian Sünner
ca. 0,8 l |
Westmark Bier
Ca. 0,5 l
|
Informationen aus Brauereiverzeichnissen
| 1898 |
Früh, Pet. Jos., Apostelnstr. 19 |
| 1910 |
Apostelnbräu, Heinr. Bädorf, Inh. Louis Berg (Lindenthal),
Dürenerstrasse 112.
Inh.: Louis Berg (S. 1898). Ggr.: 1893. Umgeb. 1902. Prok.: Eduard Berg.
F.: 3106. Tel.-Adr.: Apostelnbräu. - Dampfb. - 1 Eismasch., Syst. Linde
- Fl.-V. - ZeugI. |
| 1934 |
Aposteln-Bräu H. Baedorf, Köln-Lindenthal, Dürener Str.
112.
Das Unternehmen wurde ab 1. 1. 1934 mit der Gambrinus-Brauerei Christian
Sünner, Düren, zu der Westmark-Brauerei Christian Sünner G. m. b. H.,
Köln-Lindenthal, zusammengeschlossen. Nähere Angaben siehe dort. |
| 1934 |
Westmark-Brauerei Christian Sünner G. m. b. H.,
Köln-Lindenthal, Dürener Straße 112.
Gegründet: Eingetr. am 19. 3. 34 mit Wirkung ab 1. 1. 34 durch
Vereinigung der Gambrinus-Brauerei Christian Sünner in Düren (gegr.
1870) mit der Brauerei Aposteln-Bräu Heinr. Baedorf in Köln-Lindenthal
(gegr. 1893).
Postsch.-Konto: Köln 1104. Tel. Köln 42 041, 42 042. Telegramm:
Westmarkbrauerei. Bankverbindungen: Bankhaus J. H. Stein, Köln; Dürener
Volksbank A.-G., Düren; Sparkasse der Stadt Köln; Städtische Sparkasse,
Düren.
Stammkapital: RM 100 000. Geschäftsjahr: Kalenderjahr. Geschäftsführer:
Christian Sünner. Braumeister: Fritz Wassmann.
Bierniederlagen: Aachen, Düren (Gambrinus-Brauerei), Eschweiler u.
München-Gladbach. Betrieb: Sudwerk mit 50 Ztr. Schüttung, 2
Dampfmaschinen, 3 Eismaschinen, elektrische Eigenstromerzeugung,
automatische Faß- u. Flaschenbieranlage. Produktion: Unter- und
Obergärige Biere. |
| 1939 |
Westmark-Brauerei Christian Sünner G. m. b. H.,
Köln-Lindenthal, Dürener Straße 112.
Fernruf: S.A. 906 61. Drahtanschrift: Westmarkbrauerei. Gründung:
Eingetragen am 19. 3. 1934 mit Wirkung ab 1.1.1934 durch Vereinigung der
Gambrinus-Brauerei Christian Sünner in Düren (gegründet 1870) mit der
Brauerei Aposteln- Bräu Heinr. Bädorf in Köln -Lindenthal (gegründet
1893).
Die Hirsch-Brau A. G., Köln, übernahm am 1. 8. 1936 die Gesellschaft als
Beteiligung zu 100 %. Es wurde ein Lohnbrauabkommen mit der Hirsch-Bräu
A. G. (jetzt: Dom-Brauerei C. Funke A. G.) getroffen. Der Betrieb der
Gesellschaft auf dem Grundstück der Aposteln-Bräu Heinr. Bädorf,
Köln-Lindenthal, wurde stillgelegt.
Produktion: Unter- und obergärige; Biere, Stammkapital: 100 000 (zu
100%, im Besitz der Hirsch-Bräu A. G., Köln). Geschäftsjahr: 1. Oktober
bis 30. September. Geschäftsführer: Christian Sünner und Emil Thümmler.
Braumeister; Curt Mennicke. Bankverbindungen: Dürener Volksbank Ä. G.,
Düren; Sparkasse der Stadt Köln; Dresdner Bank, Köln. Postscheckkonto:
Köln 1104.
Das Unternehmen gehört an: Brauwirtschaftsverbund Westdeutschland, Köln;
Wirtschaftsgruppe Brauerei und Mälzerei, Berlin Bezirksgruppe Rheinland, |
Quellen
| 1 |
www.frueh.de. „Unsere Geschichte“, besucht am 24.05.2020 |
| 2 |
Thomann, Björn, Peter Josef Früh, in: Internetportal
Rheinische Geschichte, abgerufen unter: http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Persoenlichkeiten/peter-josef-frueh/DE-2086/lido/57c6c132d88ff4.49572460
(abgerufen am 16.11.2019) |
| 3 |
Artikel von Pauline Reimers über Elsie Berg, https://www.koenigin-luise-schule.de/gedenkbuchdetails/elsie-berg.html
(besucht am 27.5.2020) |
| 4 |
„Trinkt Kölner Bier - Quer durch Kölner Brauhäuser“,
Sonderbeilage des Kölner Tageblattes von Sonntag den 15. Dezember 1929 |
| 5 |
Historisches Verzeichnis alter Biergläser/Krüge aus dem
Köln/Bonner Raum, Hrsg.: Wolfgang Wukasch |
| 6 |
Greven's Adressbuch für Köln, Jahrgänge 1885 bis 1934 |
| 7 |
"Prosit Colonia", Franz Mathar, Greven Verlag Köln, 1999 |
| 8 |
Adressbuch für die gesamte Brau-Industrie Europas, Band I: Deutschland, 1898, Verlag von Eisenschmidt & Schulze, Leipzig |
| 9 |
Adressbuch für die gesamte Brau-Industrie Europas, Band I: Deutschland, 8. Jahrgang, 1910, Verlag von Eisenschmidt & Schulze GmbH, Leipzig |
| 10 |
Die Deutschen Brauereien, Firmenjahrbuch des Deutschen Brauer-Bundes, Verlag für Rechts- und Wirtschaftsliteratur A.-G., Berlin u. Leipzig, 1934 |
| 11 |
Die Brauereien und Mälzereien im Deutschen Reich 1939-40, 38. Auflage, 1940, Verlag Hoppenstedt & Co., Berlin |
| 12 |
"Kölner Kneipen im Wandel der Zeit (1846 bis 1921), Lambert Macherey, 1921, Selbstverlag |
| 13 |
"Köln auf alten Ansichtskarten", Herausgeber: Kölnisches Stadtmuseum, Michael Euler-Schmidt, Asmuth Verlag Köln, 1995 |
| 14 |
"Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich Preußischer
Staats-Anzeiger", Berlin, Ausgaben: 01.05.1900, 09.02.1908, 09.11.1912,
05.01.1925 17.01.1931, 21.08.1936, 12.05.1939, 05.06.1939, 01.10.1942 |
| 15 |
"Brauerei-Verzeichnis Deutschland", Michael Gorytzka, Manfred Friedrich, herausgegeben von der Fördergemeinschaft von Brauerei-Werbemittel-Sammlern e.V. (FvB), Ausgabe November 2009 |
| 16 |
Mülheimer Volkszeitung, Ausgabe 9. Januar 1908 |
| 17 |
Kölner Lokal-Zeitung, Ausgabe 05.12.1900 |
| 18 |
Bonner General-Anzeiger: 04.09.1906, 07.09.1906 |
| 19 |
Erste Kölner Bierzeitung, Brauerei Päffgen, Ausgabe 46 (2005) |
| 20 |
"Kölner Lokal-Anzeiger", Ausgaben 13.02.1896, 20.05.1896, 20.07.1913, 09.06.1928 |
| 21 |
"Bonner Zeitung", Ausgabe 15.01.1907 |
| 22 |
"Köln-Bergheimer Zeitung", Ausgabe 21.05.1896 |
| 23 |
"Rheinische Volksstimme", Ausgabe: 23.05.1896 |
| 24 |
Sammlung Kölner Postkarten von Detlef Ippen, www.post.koeln |