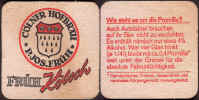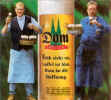"Nach Kölsch-Aus. Brauerei kündigt neues Bier an – aber kein Bio-Siegel mehr"
Artikel im Kölner Express
"Paukenschlag in Köln - Beliebte Brauerei macht dicht – Chefin verkündet Aus mit Tränen in den Augen"
Artikel im Kölner Express
Die Brauerei hat aktuell Hellers Kölsch, Hellers Wiess, Hellers Pils naturtrüb und Hellers Leicht als Flaschenbiere im Sortiment, dazu das Hellers Weizen im Sommer und ganzjährig den Hellers Bock. Das Besondere: Alle Sorten tragen das Bio-Siegel, auch damit hatte sich der Familienbetrieb (in zweiter Generation) einen Namen gemacht – jetzt das Ende. Noch bis Mitte 2024 soll das Bier weiter produziert und in Fässern angeboten werden. Die bereits produzierten und abgefüllten Flaschen werden noch verkauft, bis das Lager leer ist. Dann ist Schluss.
Aber: Das Aus für die Brauerei bedeutet nicht das Aus für das Brauhaus (auch an der Roonstraße) und den Volksgarten – sie sollen weiterhin bestehen. Auch für das Personal sollen Lösungen gefunden werden: „Natürlich wissen wir um unsere Verantwortung unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber und wir werden alle unterstützen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden“, schreibt Heller. „Aber da es sich um Spitzenpersonal handelt, sehen wir hier keine Probleme.“ Unter dem Video auf Instagram haben sich bereits in den ersten Stunden unzählige traurige Kommentare angesammelt. „Ihr seid eine Institution mit eurem etablierten Bio-Kölsch, unglaublich schade! Danke für euren großartigen Beitrag zur Kölsch-Kultur“, schreibt ein Nutzer, viele andere gehen in die gleiche Richtung.
"Rut Wiess Kölsch: Was es mit der neuen Bier-Marke auf sich hat"
Artikel im Onlinemagazin "24RHEIN" (www.24rhein.de)
Köln – Bereits seit Jahren wird der Kölsch-Markt von den bekannten Marken dominiert. Reissdorf Kölsch, Früh Kölsch, Gaffel Kölsch oder Sion Kölsch dürften inzwischen jedem ein Begriff sein, ebenso das immer beliebter werdende Schreckenskammer Kölsch oder Sünner Kölsch. Doch nun drängt eine neue Kölschsorte auf den Markt – sie ist bislang allerdings ausschließlich im Getränkemarkt Trinkgut zu bekommen und hört auf den zu den Stadtfarben passenden Namen Rut Wiess Kölsch.
Rut Wiess Kölsch neu auf dem Markt – Etikett sieht aus wie FC-Trikot
„Rut Wiess ist eine neue Kölsch-Sorte, die seit Ende April zum regulären Sortiment von Trinkgut gehört“, teilt Simone Erkens von Edeka, deren Tochter Trinkgut ist, auf 24RHEIN-Nachfrage mit. „Das Bier wird exklusiv von Trinkgut vertrieben und in Köln gebraut.“ Das Etikett ist, wie soll es anders sein, rot und weiß und per Diagonalstrich getrennt – so erinnert es ein wenig an das aktuelle Heimtrikot des 1. FC Köln. Zudem besonders: Der Plopp-Verschluss, wie ihn bislang beispielsweise Peters Kölsch anbietet
"King Kölsch: BrewDog und Früh brauen gemeinsames Kölsch"
Artikel im Onlinemagazin "Meininger Online" (www.meininger.de)
Verbunden durch die Leidenschaft, großartiges Bier mit hochwertigen Inhaltsstoffen zu brauen, haben Früh und BrewDog ihre Kräfte vereint – um gemeinsam ein Kölsch zu brauen: King Kölsch. Mit ihrer Kooperation wollen beide Brauereien eine Brücke vom Rheinland nach Schottland schlagen und nicht nur köstliches Kölsch, sondern auch die Kölsche Lebensfreude in die Welt exportieren – inklusive der dem Kölsch eigenen Trinkregeln mit Kränzen und Stangen. Ab sofort können sich also auch Kölsch-Liebhaber, die in Europa und dem Vereinigten Königreich leben, über köstlichen Heimattrunk im Handel und in über 100 Bars in Metropolen wie London, Paris, Brüssel und Berlin freuen.
Wie es die Kölsch-Konvention vorsieht, wird der edle Tropfen natürlich dort gebraut, wo man einen Blick auf den Kölner Dom erhaschen kann – in Köln. Heimspiel für Früh, Besonderheit für BrewDog. Die aus Schottland stammende Brauerei braut innerhalb Deutschlands normalerweise ausschließlich in Berlin. „Wir verbinden die Liebe zu modernen Bierstilen mit der weltweit bekannten kölschen Biertradion und ihrer einzigartigen Riten zu einem herausragend leckerem, neuen Kölsch.“ sagt Adrian Klie, CEO BrewDog Deutschland.
Auch Dirk Heisterkamp, Leiter Marketing und Vertrieb bei Früh Kölsch, ist begeistert: „Es ist eine tolle Zusammenarbeit, ein Herzensprojekt. Ich bin sehr happy mit dem Ergebnis und gespannt auf die Resonanz unserer Kunden.“
Der Collaboration Brew verbindet ebenso passend die Werte und Traditionen beider Unternehmen. Das Kölsch kommt in einem rot-weißen Gewand daher, den Farben Kölns und Frühs. Drei Kronen symbolisieren ebenfalls die Domstadt und die Kölner Traditionsbrauerei. BrewDogs unverkennbares Logo sowie sein knalliges Dekor runden das Design ab.
Das Kölsch ist mit 5,2 Prozent Alkoholgehalt um 0,4 Prozent stärker als ein herkömmliches Kölsch, kommt also mit ordentlich Wumms daher. Auch die Bittereinheiten (26 IBU) und die Stammwürze (11,8 Prozent) sind höher als gewöhnlich, was für einen extra Kick sorgt. Ein royales Fest für den Gaumen. Ganz wie es der Name des Bieres verspricht. Extra lang gelagert und kalt gereift, ist es nach den Kriterien des Slow Brewing Gütesiegels für außergewöhnliche und geprüfte Qualität gebraut. Abgefüllt wird das Bier in 0,33-Liter-Flaschen und 0,33-Liter-Dosen sowie in 30-Liter-Kegs.
"Kölner Bier-Hammer - Malzmühle übernimmt bekannte Kölsch-Brauerei"
Artikel im Kölner Express
Die beiden ältesten Kölsch-Brauereien gehen zusammen. Die Brauerei zur Malzmühle wird ab Januar 2022 die Sünner Brauerei in Köln-Kalk übernehmen.
Köln. Paukenschlag auf den Kölner Bier-Markt: Die Brauerei zur Malzmühle übernimmt Sünner Kölsch. Beide Brauereien wollen ihre Kräfte am Brauerei-Standort in Kalk bündeln, wie die Unternehmen am Montag, 4. Oktober, mitteilten. Die Brauerei zur Malzmühle, die das Mühlen Kölsch herstellt, wird ihre Produktion vom Heumarkt dorthin verlegen.
Köln: Mühlen-Kölsch übernimmt Sünner-Kölsch ab 1. Januar 2022. Durch Absatzsteigerungen bei Mühlen Kölsch war der Standort Heumarkt an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. Ein Neubau in Lövenich wurde zeitweise in Betracht gezogen, nun aber mit Sünner eine optimale Lösung gefunden, wie beide Seiten betonen. Denn: Sünner hatte aufgrund der Kneipen-Schließungen während der Pandemie zu kämpfen und kann jetzt vermelden, dass es die Marke Sünner weiter geben wird.
„Alle Sünner-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter übernehmen wir. Gemeinsam mit unseren 150 Mitarbeitern werden wir ein starkes Kölner Team bilden“, sagt Mühlen-Chef Michael Rosenbaum. Auch die Gastronomie Sünner Keller & Biergarten werde mit übernommen.
Mühlen-Kölsch: Alle Arbeitsplätze bei Sünner in Köln-Kalk werden erhalten. „Wir sind dankbar, dass wir hier nun gemeinsam mit der Brauerei zur Malzmühle eine Möglichkeit gefunden haben, sowohl die Marke Sünner und ihre Produkte als auch den Standort in Köln-Kalk in seiner ursprünglichen Form der Nutzung mitsamt seinen Arbeitsplätzen zu erhalten,“ sagt Sünner-Chefin Astrid Schmitz-DuMont. Melanie Schwartz und Michael Rosenbaum, die beiden Geschäftsführer der Malzmühle, betonen: „Wir sehen für beide Marken trotz hartem Wettbewerbsdruck für die nächsten Jahre gute Wachstumspotenziale“. Die Familienbrauerei Sünner ist nach eigenen Angaben die älteste Kölsch-Brauerei: Seit 1830 wird dort Bier hergestellt. 1858 wurde die Familienbrauerei zur Malzmühle gegründet.
"Radeberger verlagert Kölsch-Produktion zur Konkurrenz"
Artikel in der Getränke Zeitung
Zukunftsorientierte und gemeinsame Nutzung eines Standortes:
Dr. Niels Lorenz, Sprecher der Geschäftsführung der Radeberger Gruppe, der diese Lösung für das Tochterunternehmen verhandelt hat: „Wenn in ein und derselben Stadt gleich mehrere Brauereien Produktionsstandorte ähnlicher Größenordnung unterhalten, jeder mit hohen Investitions- und Instandhaltungsbedarfen, dann kann man nicht nur, dann muss man fast zwangsläufig ganz pragmatisch über eine zukunftsorientiert gemeinsame Nutzung dieser Anlagen nachdenken.“ Schließlich können nach Einschätzung des Brauereichefs dadurch nicht nur Synergien mit Blick auf Kapazitäten und Investitionen gehoben werden, er betont auch: „Wenn zwei Brauer ihre Mengen produktionsseitig zusammenlegen, entsteht ein optimal zugeschnittener und ausgelasteter Standort, der in einem tendenziell schwierigen Bier- und Kölschmarkt noch zukunftssicherer betrieben werden kann – für beide Parteien.“
Und auch Alexander Rolff, persönlich haftender Gesellschafter der Cölner Hofbräu Früh, zeigt sich von dem Ansatz angetan: „Im ersten Moment fanden wir die Idee ungewöhnlich. Doch die Vorteile liegen auf der Hand: Wir stellen unseren Standort damit planerisch und investiv auf zukunftssicherere Beine und können unseren Kunden bei ihren Abholungen ein noch attraktiveres Angebot machen. Unser Unternehmen ist heute prächtig aufgestellt, unser Früh Kölsch entwickelt sich seit Jahren besser als der Markt und wir erfreuen uns einer stetig wachsenden Beliebtheit bei den Kölsch-Freunden, trotzdem sind wir überzeugt: Auch wir müssen uns verändern, um unsere Spitzenposition dauerhaft zu behaupten.“
Die beiden Brauereien werden nach eigenem Bekunden im Bereich der Herstellung, Abfüllung und Logistik partnerschaftlich kooperieren, in allen anderen Fragen der Markenführung und des Vertriebs aber in einem gesunden Wettbewerb verbleiben. Alexander Rolff: „Wir werden unseren erfolgreichen Weg in der Markenführung und im Vertrieb unserer Marke Früh unverändert weitergehen. Denn so partnerschaftlich wir uns durch den Schulterschluss in ausgewählten Bereichen auch begegnen, so klar treten wir auch weiterhin als Wettbewerber um Marktanteile und Verbrauchergunst an.“ Und Georg Schäfer, Geschäftsführer des Haus‘ Kölscher Brautradition, ergänzt: „Wir werden zwar gemeinsam produzieren, aber getrennt marschieren. Denn eines ist klar: In unserem Markt kämpft jeder Brauer um jeden Kunden, jede Gastronomie, jeden Zentimeter. Wir treten als Haus Kölscher Brautradition mit unseren Kölsch-Marken auch nach dem Schulterschluss selbstbewusst an, unser Terrain zu verteidigen. Gegen Freund und Feind, wenn Sie so wollen …“
"Viking Kölsch gelauncht"
Artikel in der Getränke Zeitung
Bei der offiziellen Präsentation in der Kölner Gaffel Brauerei zeigte sich sowohl Heinrich Philipp Becker, geschäftsführender Gesellschafter Gaffel, als auch der CEO und Inhaber der Mikkeller Brauerei aus Kopenhagen, Mikkel Borg Bjergsø, sehr zufrieden mit dem entstandenen Produkt. „Mit dem Viking Kölsch haben wir ein crafbierähnliches Kölsch kreiiert, das absolut neu für den Verbraucher ist. Viking Kölsch ist nicht nur cool – es schmeckt auch noch!“, zeigte sich Becker sichtlich zufrieden.
An der Kollaboration gereizt habe den Gaffel-Chef, der von sich und seinen Mitarbeitern stetige Flexibilität fordert, unter anderem die Symbiose von alt und neu: „Gaffel hat eine lange Tradition. Das gepaart mit einem Craftbier, gibt ein völlig neues Geschmackserlebnis für den Konsumenten.“
Drei Monate hat es vom ersten Treffen von Gaffel mit Mikkeller zum fertigen Viking Kölsch gebraucht. Gebraut wird bei Gaffel, das in Köln nicht nur eine hochmoderne Mikro-Brauanlange sein Eigen nennt, eine Anlage, die prädestiniert ist für kleinere Mengen. 1.200 Liter Viking Kölsch wurden zunächst gebraut.
In rund vier Wochen wird es dann online und im Brauhaus „Gaffel am Dom“ verfügbar sein. Wie es mit dem Viking Kölsch weitergeht, müsse man sehen, meint Becker: „Es ist ein Projekt, von dem man sehen muss, wie es sich entwickelt. Aber klar ist: Dieses feine, edle Produkt ist als limitierte Edition gedacht.“
"Bier und Pizza - „Birreria“ verbindet kölsche Braukunst mit italienischer Küche"
Artikel in der Kölner Rundschau von Luis Kuminka
"Brauereien unter Druck - Revolution auf dem Kölschmarkt"
Artikel im Kölner Express von Bastian Ebel
Köln - Kölle, Karneval, lecker Kölsch - der ewige Dreiklang. In der Session kommt jetzt richtig Bewegung auf den Markt - Knallgas bei den Brauereien!
Der Hammer: Das über 100 Jahre alte Dom-Kölsch hat sein traditionelles grün abgestreift und durch rot ersetzt. Außerdem mischt ein neues Billig-Kölsch für 45 Cent den Markt auf: das „Colonius“!
Zum überraschenden Farbwechsel bei Dom sagt Georg Schäfer, Sprecher der Geschäftsleitung im Haus Kölscher Brautradition (die Marke Dom gehört unter das Kölsch-Dach der Radeberger-Gruppe mit Sion, Gilden und Co.): „Jetzt bekennen wir kräftig Farbe und setzen ein deutliches Signal im Kölsch-Markt.“ Er räumt dabei ein: „Wir mussten was tun.“
Dass Dom jetzt in rot daherkommt, sei Ergebnis einer Marktforschungsanalyse gewesen:„ Dabei ist das alte Design durchgefallen. Da waren neue Ideen geboten“, so Schäfer weiter. Dass Dom-Kölsch im Auftreten zu anderen erfolgreichen, rotgeprägten Marken wie Früh oder Reissdorf konkurrieren könnte, sieht er nicht. „Wir heben uns da deutlich ab und haben ja auch nur drei Buchstaben“, lächelt er.
Ein Insider in leitender Position einer anderen Kölner Brauerei sagt gegenüber EXPRESS: „Das ist der letzte Griff nach dem Strohhalm, denn Dom Kölsch spielt im großen Markt keine Rolle.“
Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbands, urteilt: „Die farbliche Umbenennung ist außergewöhnlich – insbesondere für so eine bekannte Kölschmarke.“ Für den Verband ist der Farbwechsel „völlig unproblematisch. Wir achten darauf, dass das Reinheitsgebot eingehalten wird. Das ist ja unverändert.“
Die Brauereien kämpfen seit Jahren mit sinkenden Umsätzen. Und so ist Dom nicht die einzige Marke, die sich Gedanken um ihr Äußeres macht. Seit dem Jahreswechsel steht ein neues, günstiges Obergäriges in den Supermarkt-Regalen: Das Kölsch trägt den Namen „Colonius“ und ist ein Produkt der Handelskette trinkgut und der Marke Traugott Simon.
Der Hersteller hatte seit 2007 das „Traugott Simon Kölsch“ als Billig-Kölsch vertrieben. Nun gibt’s ein Facelift. Beim Nachfolger „Colonius“ handelt sich erneut um ein Kölsch der unteren Preiskategorie.
Gebraut wird das Kölsch in den Kesseln der Sünner-Brauerei an der Kalker Hauptstraße in Köln-Kalk.
Den Kasten gibt's aktuell bei Netto für 8,99 Euro, die Flasche für 45 Cent (zzgl. Pfand). Damit liegt der Preis pro Kasten vier bis fünf Euro unter den Angeboten der bekannten und etablierten Kölsch-Marken.
Ob es aber auch geschmacklich mithalten kann, das muss der wahre Kölsch-Liebhaber wohl im Selbstversuch in Erfahrung bringen...
"Kölsch-Panscher hatten Eigenmarke"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Claudia Hauser
Köln. „Bachsteiner – ob obergärig, Pils oder Alt im Fass, immer ein Genuss.“ Im Logo ist ein kupferner Maischbottich zu sehen, davor kreuzen sich Gerstenhalme und im Hintergrund prangt das Kölner Wappen. Sinan E. (Name geändert) bewirbt auf seiner Homepage die Hausmarke seines Getränkehandels. Der 34-Jährige und sein Bruder (42) stehen im Verdacht, minderwertiges Bier in Hunderte Leerfässer gefüllt und unter dem Namen renommierter Brauereien verkauft zu haben. Aber nicht nur das: Haben die beiden Männer auch ihr Hausbier als teures Kölsch verkauft? Damit jedenfalls beschäftigen sich derzeit die Ermittler.
Nach den Durchsuchungen des Getränkemarkts in der Feldgärtenstraße in Niehl am Dienstag richten sich die Ermittlungen der Polizei nun auch gegen einen möglichen Lieferanten. Es soll sich um eine kleine Brauerei im Sauerland handeln. Die Polizei stellte auch dort Fässer sicher, ein Sprecher der Behörde betont: „Die Herkunft des Billigbieres selbst ist noch nicht abschließend geklärt.“ Die beschlagnahmten Fässer sind überwiegend Kölsch-Fässer unterschiedlicher Brauereien, die meisten waren mit Etiketten von Sion, Reissdorf oder Gilden beklebt, die sich die Beschuldigten entweder illegal besorgt oder die sie gefälscht haben. Die Früh-Brauerei hat in einer Kneipe im Rechtsrheinischen fünf Fässer mit dem gepanschten Bier entdeckt. „Die Gaststätte wurde seit Jahren von den Getränkehändlern beliefert“, sagt Marketing-Chef Dirk Heisterkamp. Sein Bier könne jeder Wirt dort kaufen, wo er wolle, wenn er nicht an eine Brauerei gebunden sei.
„Wir müssen auf unsere Marke Kölsch aufpassen“
Auch wenn die Polizei gegen die Gastronomen ermittelt, die die Fässer abgenommen haben, kann es sein, dass der eine oder andere Wirt nicht gemerkt hat, dass er kein Kölsch, sondern eine billige Fälschung gekauft hat. „Wir suchen Wirte, die bei der Firma gekauft und sich nun betrogen fühlen, erst einmal als Zeugen“, sagt der Polizeisprecher. Christian Kerner, Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbands, bezweifelt, dass ein Gastwirt ein Original-Fass nicht von einem gefälschten unterscheiden kann. „Es kann natürlich sein, dass es Original-Fässer waren.“ Dann allerdings bliebe die Frage, woher die Täter die Fässer hatten. „Es gibt eigentlich keinen Markt für gebrauchte Fässer“, sagt Kerner. „Vielleicht haben die Händler den Wirten angeboten, die Fässer mitzunehmen und haben dann auf das Pfand von 30 Euro verzichtet und die Behälter für ihre Zwecke weiterverwendet.“ Das alles müssten die Ermittlungen zeigen. „Wir müssen auf unsere Marke Kölsch aufpassen“, sagt Kerner. Er ist sicher, dass die Täter die Strukturen des Brauerei-Wesens sehr gut gekannt haben.
Am Donnerstag wurden alle sichergestellten Fässer auf das Gelände der Reissdorf-Brauerei gebracht und von dort an die geschädigten Firmen zurückgegeben. 1000 50-Liter-Fässer waren beschlagnahmt worden. „Die betroffenen Brauereien werden nun gutachterlich prüfen, ob es sich bei dem Inhalt wirklich um die jeweils angegebene Marke handelt“, sagt der Polizeisprecher.
„Bei uns läuft 88 Prozent des Verkaufs über Getränkefachgroßhändler“, sagt Reissdorf-Geschäftsführer Michael von Rieff. Wer eine Kneipe eröffne, könne sich eine Erstausstattung mit Gläsern von einer bestimmten Brauerei besorgen. Das Kölsch muss er aber nicht bei der Brauerei kaufen.
Die Ermittlungen dauern an. Wirte, sich betrogen fühlen, werden gebeten, sich unter Telefon 0221/229-0 zu melden.
"Kölsch-Brauer sind besorgt"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Willi Feldgen
Der nordrhein-westfälische Verbraucherschutzminister Johannes Remmel (Grüne) hat ein mögliches Aus für regionale Produktbezeichnungen im Rahmen des Freihandelsabkommen TTIP mit den USA scharf kritisiert. Der Vorstoß von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sei ein „Irrweg zulasten des Verbrauchers“, erklärte Remmel am Montag in Düsseldorf. Mit dem Vorschlag, regionaler Produktbezeichnungen abzuschaffen, stelle Schmidt die Interessen internationaler Nahrungsmittelkonzerne über die Interessen der Verbraucher und der heimischen Landwirtschaft.
Gerade die Bundesrepublik habe den EU-Schutz für Regionalprodukte ständig eingefordert, betonte Remmel. Gekennzeichneter heimischer Spargel oder Aachener Printen sicherten heimische Wertschöpfung und lieferten den Verbrauchern Sicherheit mit Blick auf die Qualität.
Als „irritierend“ bezeichnet der Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbands, Rechtsanwalt Christian Kerner, die Aussagen des Bundeslandwirtschaftsministers: „Wir betrachten das mit großer Sorge und werden uns dagegen wehren“. Der Kölner Brauerei-Verband setze sich dafür ein, dass die Marke Kölsch als regionale Bezeichnung geschützt bleibt und für den Verbraucher klar und eindeutig erkennbar ist, dass Kölsch grundsätzlich nur im Stadtgebiet von Köln gebraut werden darf. Würden die Regeln der von der EU anerkannten Kölsch-Konvention, für die die Brauer lange gekämpft hätten, „erst mal eingerissen, wäre es schnell um den Schutz geschehen“, sagte Kerner.
Der Verband fordert daher den Landwirtschaftminister auf, sich auch künftig für den Schutz regionaler Lebensmittel durch die EU einzusetzen. In Europa geht der Kölner Brauerei-Verband immer wieder gegen Anbieter vor, die ihr Bier unrechtmäßig als „Kölsch“ oder „kölsch style“ bezeichnen. Erst kurz vor Weihnachten seien entsprechende Anbieter in Italien und in den Niederlanden abgemahnt worden. In den USA und in Südamerika sei dies allerdings schwieriger.
1250 Agrarerzeugnisse aus der EU tragen das Gütezeichen. Angesichts einer solchen Vielzahl begrüßt Stephan-Becker Sonnenschein, Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft „Die Lebensmittelwirtschaft“, den Vorstoß des Bundesministers: „Wir können nicht Freihandel wollen und gleichzeitig jeden Blumenkohl schützen.“ Es sei notwendig, die EU-Praxis auf den Prüfstand zu stellen und zu hinterfragen, ob die Regelungen wirklich dem Verbraucherschutz und der Lebensmittelqualität dienten.
Aus Sicht von Verbraucherschützern darf es aber nicht um die Frage nach weniger Informationen über Herkunft und Herstellungsverfahren gehen, sondern um besser verständliche und eindeutigere Angaben. „Auch wir kritisieren die EU-Siegel seit langem, allerdings aus einem anderen Grund: Sie sind für die Kunden nicht oder nur schwer verständlich“, sagt Sophie Herr, Lebensmittelexpertin beim Bundesverband Verbraucherzentrale.
"Gaffel verlässt den Eigelstein"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von A. Damm und C. Schulz
Die Gaffel-Brauerei zieht vom Eigelstein in der Innenstadt nach Köln-Gremberghoven. Die Produktionsstätte in dem Wohngebiet sei zu klein geworden, erklärt das Unternehmen. Einige der 110 Arbeitsplätze fallen mit dem Umzug weg.
Gaffel, eine der wenigen verbliebenen Familienbrauereien, verlässt die Innenstadt und verlegt die Produktion ab August nächsten Jahres vom Eigelstein nach Porz-Gremberghoven. Die Produktionsstätte im Stadtzentrum sei zu klein geworden, heißt es von Gaffel. Ein Ausbau der Kapazitäten der Braustätte, die sich mitten in einem Wohngebiet befindet, wäre nicht möglich. Das 2000 Quadratmeter große Areal solle demnächst verkauft werden, erste Sondierungsgespräche mit potenziellen Käufern und Projektentwicklern hätten bereits stattgefunden.
Seit 1908 sitzt Gaffel, das zuletzt durch Streit unter den Gesellschaftern von sich Reden machte, auf dem Eigelstein. Mit dem Wegzug verliert das einstige Zentrum kölscher Braukunst sein letztes Bier- Unternehmen. Vor knapp 200 Jahren sollen im Eigelstein-Viertel 18 Brauereien und noch mehr Schenken beheimatet gewesen sein. Hier stärkten sich seit je her Reisende, die durch die Eigelsteintorburg nach Köln gekommen waren.
Einige Arbeitsplätze werden abgebaut
In Porz auf dem Gelände der ehemaligen Richmodis-Brauerei, die Gaffel 1998 von Karlsberg einschließlich der neuen Braustätte übernommen hatte, wird bereits seit längerem ein Teil des Kölsches gebraut. Jetzt sollen die Anlagen auf dem 30.000 Quadratmeter großem Gelände ausgebaut werden.
Schärferer Wettbewerb und Preis- und Kostendruck erforderten effizientere Produktionsbedingungen, begründet Gaffel den Umzug. „Viele mittelständische Brauereien sind von Großkonzernen übernommen worden. Wir wollen als Familienbrauerei langfristig eigenständig bleiben. Um diesen Weg nachhaltig zu sichern, brauchen wir modernste Brauanlagen“, sagt Heinrich Philipp Becker, geschäftsführender Gesellschafter bei Gaffel. Das Unternehmen hole damit einen Schritt nach, den andere Kölsch-Brauereien bereits vor Jahren getätigt hätten.
Zwei Beispiele: Das Traditionsunternehmen Früh errichtete Mitte der 1980er Jahre eine neue Braustätte in Feldkassel am nördlichen Stadtrand. 1998 gab Reissdorf sein Stammhaus im Severinsviertel und zog mit der Produktion in das Gewerbegebiet Rodenkirchen. Zu den wenigen Unternehmen, die ihren Sitz in der Innenstadt halten, gehört Päffgen. Die nach eigenen Angaben „älteste Hausbrauerei Kölns“ hat ihre Kessel nach wie vor im Friesenviertel.
Wie viele der 40 Gaffel-Mitarbeiter vom Eigelstein nach Porz ziehen, ist noch unklar. Durch die Konzentration des Brauprozesses würden zwangsläufig einige der insgesamt 110 Arbeitsplätze abgebaut. In erster Linie beträfe das Beschäftigte mit befristeten Zeitarbeitsverträgen, heißt es bei Gaffel.
"Neue Runde im Gaffel-Streit"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von W. Feldgen und C. Schulz
Im Zwist der Becker-Boys bei der „Gaffel“-Brauerei ist kein Burgfriede in Sicht. Johannes Becker (64), der 2007 von seinem Bruder Heinrich (67) als Geschäftsführer der Kölner Brauerei ausgebootet worden war, will der langen Liste von Klagen eine weitere folgen lassen: Er möchte immer noch erreichen, dass Heinrich von seinem Posten als Geschäftsführer des Unternehmens ebenfalls abgesetzt wird. Allerdings ist Heinrich Mehrheitsgesellschafter und hat damit das Sagen in der Brauerei: Er hält über 60 Prozent der Brauerei-Anteile, Johannes kommt lediglich auf knapp 40 Prozent.
Erfolg vor Gericht
Vor Gericht hatte Johannes allerdings Ende 2013 einen kleinen Zwischenerfolg verbuchen können: Das OLG Köln hatte entschieden, dass nach Johannes nun zwangsweise auch Heinrich Becker von seinem Posten als Geschäftsführer zurücktreten muss. Doch der ältere Bruder hat dagegen Berufung eingelegt: Das Urteil ist also noch nicht rechtskräftig.
Nun legt Bruder Johannes nach. Vorlage für ihn ist der Bußgeldbescheid des Bundeskartellamtes gegen Heinrich Becker. Er soll 2007 an illegalen Preisabsprachen für Fass- und Flaschenbier teilgenommen und anschließend den Preis für einen Kasten Gaffel-Kölsch um einen Euro angehoben haben. 3,1 Millionen Euro soll die Gaffel-Brauerei deswegen zahlen. Heinrich Becker, gegen den auch eine persönliche Strafe verhängt wurde, will das aber nicht akzeptieren und hat Einspruch gegen den Strafbescheid des Kartellamts eingelegt.
Für Johannes Becker ist der Strafgeldbescheid des Kartellamtes Grund genug, eine erneute Klage gegen Heinrich vorzubereiten, um ihn zwangsweise von der Spitze des Unternehmens entfernen zu lassen. Angesichts des seit etlichen Jahren erbittert geführten Streits, bei dem jede Menge Porzellan zerschlagen wurde, spricht allerdings wenig dafür, dass Johannes jemals wieder auf den angestrebten Posten als Geschäftsführer der Gaffel zurückkehren wird.
Vermutlich wäre Heinrich Becker mit Erreichen des üblichen Pensionsalters ganz gerne von seinem Geschäftsführer-Posten zurückgetreten, um sich mit mehr Muße seinen diversen Hobbys widmen zu können. Doch nun bleibt er im Amt: um den Sohn, der seine Nachfolge antreten soll, nicht allein zu lassen, aber vielleicht noch mehr aus Trotz – damit sein Bruder keinen Erfolg feiern kann. Das ist allerdings keine Lösung auf Dauer: Irgendwann wird auch Heinrich seinen Posten an der Gaffel-Spitze räumen müssen.
Einspruch eingelegt
Derweil schwebt über der Kölner Traditionsbrauerei weiter die drohende Kartellstrafe. Die wurde Anfang des Jahres vom Bundeskartellamt im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen die Bierbranche in ganz Deutschland verhängt. Fast 340 Millionen Euro müssen elf Brauereien bundesweit sowie 14 persönlich Verantwortliche zahlen, weil sie nach Einschätzung der Behörde illegale Preisabsprachen getroffen haben.
Neben den großen Platzhirschen wie Radeberger und Carlsberg, sind auch die regionalen Brauereien Bolten und Erzquell (Zunft Kölsch) aus Wiehl-Bielstein betroffen. Und auch Gaffel und Früh müssen zahlen ebenso wie der Brauereiverband NRW. Dabei entfallen neben den 3,1 Millionen Euro auf Gaffel dem Vernehmen nach drei Millionen Euro auf Früh, Zunft soll mit einer deutlich niedrigeren Summe davonkommen.
Neben Gaffel und Früh hat auch der Brauereiverband NRW Einspruch beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt. Früh-Chef Alexander Rolff, gegen den als Gesellschafter des Unternehmens eine persönliche Strafe verhängt wurde, hat dem Vernehmen nach zudem Berufung in Düsseldorf eingelegt.
Ein Vergleichsangebot im Vorfeld des Bescheides hatte Früh nach eigenen Angaben bewusst abgelehnt. Das Unternehmen hätte mit einem Schuldeingeständnis einen Nachlass auf das Bußgeld von bis zu zehn Prozent bekommen können. Das Traditionshaus sieht sich ebenso wie Gaffel allerdings zu Unrecht bezichtigt.
Sollten sich die Vorwürfe vor Gericht allerdings nicht entkräften lassen, könnten die Strafen für die Brauer noch höher ausfallen als bisher, denn im Gerichtsverfahren würde eine komplett neue Beweisführung eröffnet. Eingestellt wurde vom Kartellamt ein weiteres Verfahren wegen angeblicher Preisabsprachen beim Kölsch, weil lokale Preisabsprachen nicht nachgewiesen werden konnten.
"Kartellstrafe - Kölsch-Brauer wollen sich wehren"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Corinna Schulz
Gaffel und Früh müssen rund drei Millionen Euro Strafe wegen illegaler Preisabsprachen zahlen. Die Kölner Brauer ziehen dagegen vor Gericht. Überraschend wurden jedoch die Ermittlungen gegen das Kölsch-Kartell eingestellt.
Köln. Es ist eine der höchsten Strafen, die das Bundeskartellamt jemals verhängt hat. Fast 340 Millionen Euro müssen elf Brauereien bundesweit sowie 14 persönlich Verantwortliche zahlen, weil sie nach Einschätzung der Behörde illegale Preisabsprachen getroffen haben. Neben Radeberger und Carlsberg, sind auch die regionalen Brauereien Bolten und Erzquell (Zunft-Kölsch) aus Wiehl-Bielstein betroffen. Die Kölsch-Brauer Früh und Gaffel müssen ebenso zahlen wie der Brauereiverband NRW – zusammen mit den anderen großen Brauereien insgesamt 231 Millionen Euro. Dabei entfallen dem Vernehmen nach drei Millionen Euro auf Gaffel und Früh, Zunft soll mit einer deutlich niedrigeren Summe davon kommen.
Bereits im Januar hatte das Kartellamt Bußgeldbescheide in Höhe von 106,5 Millionen Euro verschickt – unter anderem an Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner und Ernst Barre. Von allen Beteiligten wurden die Strafen damals akzeptiert.
Früh und Gaffel hingegen wollen ebenso wie Carlsberg und Radeberger Einspruch beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen. „Wir haben den Bescheid bekommen, halten diesen jedoch aus einer Mehrzahl von Gründen für falsch und werden dagegen Rechtsmittel einlegen“, sagte Thomas Deloy, Marketingchef bei Gaffel, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Auch Früh-Chef Alexander Rolff will gegen das Bußgeld vorgehen. „Der Vorwurf der Preisabsprache ist schlichtweg falsch“, so Rolff.
egen ihn als Gesellschafter des Unternehmens wurde zudem auch eine persönliche Strafe verhängt. „Das Kartellamt hat uns bis heute nicht angehört, wir möchten die Vorwürfe vor Gericht klären lassen.“ Ein Vergleichsangebot im Vorfeld habe Früh deshalb bewusst abgelehnt. Das Unternehmen hätte mit einem Schuldeingeständnis einen Nachlass auf das Bußgeld von bis zu zehn Prozent bekommen können.
Sollten sich die Vorwürfe vor Gericht allerdings nicht entkräften lassen, könnte die Strafe für Gaffel und Früh noch höher ausfallen als bisher, denn im Gerichtsverfahren würde eine komplett neue Beweisführung eröffnet. Vom Zunftbrauer Erzquell war gestern ebenso wenig eine Stellungnahme zu den Vorgängen zu bekommen wie vom Brauereiverband NRW.
In einem weiteren Verfahren können sich die Kölner Brauer mittlerweile entspannen. Die Ermittlungen beim sogenannten Kölsch-Kartell gegen fünf Brauereien wurden gestern überraschend eingestellt. Ende 2011 hatten Fahnder unter anderem die Geschäftsräume von Gaffel und Früh durchsucht. Auch hier hatte das Kartellamt Absprachen über Preise sowie den Bierausstoß vermutet. Aber offensichtlich reichten die Beweise nicht aus. Dem Vernehmen nach wäre der Aufwand für weitere Ermittlungen in diesem Fall zu groß gewesen.
"Gaffel-Brauerei wird nicht versteigert"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Willi Feldgen
„Streit an allen Fronten“ und eine „unheilbare Zerrüttung“ bescheinigte Burkhard Gehle, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Köln, den Brüdern Heinrich und Johannes Becker. Die beiden Gesellschafter der Gaffel-Brauerei trafen sich wieder einmal – vertreten von jeweils drei Anwälten – vor Gericht. Seit 35 Jahren sei das Verhältnis der Brüder „von Sprachlosigkeit gekennzeichnet“, sagte einer der Anwälte.
- Auflösung drohte -
Minderheitsgesellschafter Johannes Becker, der 2007 auf Beschluss der Gesellschaftermehrheit von der Geschäftsführung der Gaffel-Brauerei ausgeschlossen worden war, kämpft gegen diese Entscheidung und fordert nun außerdem die Abberufung seines Bruders von der Geschäftsführung sowie die Auflösung der Gesellschaft. Folge davon wäre, dass die Gaffel-Brauerei versteigert werden müsste.
Gehle machte den Parteien deutlich, dass das Gericht das Unternehmen nicht auflösen und versteigern lassen werde. „Der Bestand des Unternehmens hat Vorrang vor solchen tiefgreifenden Lösungen“, sagte Gehle. Das Gericht kündigte an, sowohl Johannes als auch Heinrich Becker abzuberufen und so einen Generationenübergang zu ermöglichen: Alleiniger Gaffel-Geschäftsführer würde dann Heinrichs Sohn Heinrich Philipp Becker.
Johannes Becker hält eine Minderheitsbeteiligung an Gaffel. Heinrich Becker ist Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer.
Beide Seiten zeigten sich mit einer solchen Lösung unzufrieden. Die Anwälte von Johannes Becker plädierten erneut für die Auflösung des Unternehmens, aufseiten Heinrich Beckers hieß es, durch eine Abberufung werde es keine Befriedung zwischen den Brüdern geben, sondern „ein wohl noch stärkeres Trommelfeuer gegen Heinrich Philipp Becker“. Gehlen sagte, die Richter wüssten nicht, was sie „Anderes, Besseres machen sollen“. Das Urteil wird am 19. Dezember verkündet.
- Interna verraten? -
Gleich nach diesem Termin ging es vor demselben Senat zwischen Becker und Becker weiter: Dabei stritten Heinrich Becker und sein Sohn gegen Johannes Becker junior. Dabei geht es um den Getränkegroßhändler Lütticke & Tschirschnitz (L&T), der auch Gaffel-Kölsch vertreibt und bei dem die Eigentumsverhältnisse genau umgekehrt sind: Bei L&T hält Johannes Becker jr. die Mehrheit und die Gaffel-Brauerei eine Minderheit. Gaffel wirft nun Johannes Becker jr. vor, L&T habe bei Verhandlungen mit diversen Brauereien über einen Kauf des Getränkehändlers wichtige Interna aus der Gaffel-Brauerei an die Kaufinteressenten weitergegeben.
Heinrich Becker befürchtet, dass L&T zunächst verkauft und der Käufer anschließend dabei unterstützt werden soll, die Gaffel-Brauerei doch noch aufzulösen und im Endeffekt auch zu übernehmen. Als ein Interessent für L&T (und vielleicht auch für Gaffel) gilt der Braukonzern Radeberger, der gerade die Marke Dom-Kölsch übernommen hat.
"Brauereiriese kauft Dom"
Artikel in der Kölnischen Rundschau
Dom Kölsch hat aber schon bessere Tage gesehen. Vor einem Jahrzehnt sah sich die damals börsennotierte Brauerei noch als Verfolger der großen Privatbrauereien, die den Kölsch-Markt mit einem Volumen von gut zwei Millionen Hektoliter dominieren.
Dom hatte 2002 noch von einem Ausstoß von einer Million Hektoliter geträumt. Die eigene Braustätte in der Tacitusstraße hatte das Unternehmen aufgegeben und die entsprechend große Küppers-Brauerei in Bayenthal erworben. Hier wurde zeitweise Küppers im Lohnbrau-Verfahren hergestellt. Die Träume platzten. Dom musste das Gelände verkaufen, fuhr zwischenzeitlich hohe Verluste ein, Dividenden fielen aus, Kapital musste nachgeschossen werden. 2010 wurde die Börsennotierung eingestellt, nachdem der Großaktionär "Vertriebsgesellschaft deutscher Brauereien" die Kleinaktionäre aus der Gesellschaft herausgepresst hatte. Die Dom-Brauerei AG wurde umbenannt, diese neue Gesellschaft wurde insolvent.
Davon war die Tochter "Dom-Brauerei GmbH Produktion und Vertrieb" zwar nicht betroffen. Doch dem Unternehmen fehlte weiter Geld für Marketing und die Akquise neuer Absatzstätten, wie auch im Geschäftsbericht für 2010 im Bundesanzeiger nachzulesen ist.
Branchenexperten schätzen den Absatz auf rund 50 000 Hektoliter. Dom hat für 2010 Absatzzahlen in ähnlicher Größenordnung angegeben. Nach Abgabe der Markenrechte an Flaschenbieren für Giesler- und Rats-Kölsch, die für 20 000 Hektoliter Absatz standen, sei der Absatz um 27,8 Prozent gesunken.
Großkunden für Fassbier sind die Sartory-Säle und das Gürzenich in Köln. Stolz war Dom auch immer auf den Bierverkauf im Eltzhof in Köln-Wahn. Gebraut wird Dom als Lohnbrau bei Erzquell (Zunft-Kölsch) im oberbergischen Wiehl. Aber wohl nicht mehr lange. Nach Ablauf des bestehenden Lohnbrauvertrages wird Dom am Radeberger-Standort in Köln-Mülheim hergestellt, so Kleppien. Hier werden nach Branchenschätzungen rund 400 000 Hektoliter Bier hergestellt. Damit ist das Haus Kölscher Brautradition in einer Liga mit Gaffel und Früh. Die Nummer eins bei Kölsch ist Reissdorf.
Die Oetker-Tochter Radeberger ist nach eigenen Angaben mit einem Marktanteil von 15 Prozent Marktführer im deutschen Biermarkt. Sie hat 14 Bier-Standorte. Neben den Kölsch-Marken Sion, Gilden, Küppers, Sester und Peters gehören zu ihr Jever, Berliner Pilsner, Dortmunder Kronen, Stuttgarter Hofbräu oder Tucher. Außerdem gehören zu Radeberger die Marke Bionade und eine Mineralquelle.
"Gaffel aus dem Getränkehandel gedrängt"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger
Tschirschnitz wies das Gericht zurück (Az: 88 O 36-12). Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Hintergrund der Auseinandersetzung ist der seit Jahren geführte Streit zwischen den Brüdern Johannes und Heinrich Becker. Johannes Becker besitzt eine Minderheit an der Gaffel-Brauerei, Heinrich Becker die Mehrheit. Bei dem - im Kölner Biermarkt besonders wichtigen - Getränkelieferanten ist es umgekehrt: Johannes Becker jr. hält hier die Mehrheit, während der Gaffel-Brauerei nur ein Minderheitsanteil von 25,1 Prozent gehört. Seitens der Gaffel habe es wiederholt "Störmanöver" gegeben, um der Gesellschaft L&T zu schaden, sagte Michael Falter, der Anwalt von Johannes Becker. Das Gericht sei mit seiner Entscheidung dieser Einschätzung gefolgt. Die Entscheidungsgründe wurdenbisher nicht genannt. Sie sollen am Dienstag mitgeteilt werden.
"Gaffel-Chef Heinrich Becker gibt seine Verbandsämter ab"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Willi Feldgen
Heinrich Becker ist ein echter Rheinländer: Der geborene Kölner denkt positiv, ist gesellig, er feiert den Karneval und lacht gerne. So könnte der Mehrheitsgesellschafter der Privat-Brauerei Gaffel Becker & Co. oHG (er hält knapp
68 Prozent, sein Bruder Johannes 32 Prozent; im Alter von inzwischen 66 Jahren eigentlich frohgemut auf sein langes Berufsleben zurückschauen, wenn er nun nach und nach seine Ämter in den Brauerei-Verbänden abgibt: Nach 25 Jahren als Vorsitzender des Verbandes rheinisch-westfälischer Brauereien tritt er diesen Donnerstag auf der Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wiederwahl an, und nach 30 Jahren wird er am sich am 12. Juni auch als Vorstand des Kölner Brauerei-Verbands von seinen Kollegen verabschieden. Weh ist ihm dabei offenbar nicht ums Herz: ,,Der Verband ist heute nicht mehr der von vor 30 Jahren. Durch die vielen Fusionen in den vergangenen Jahrzehnten ist die Zahl der Mitglieder ja deutlich zurückgegangen", sagt Becker. Ein bisschen mehr Zeit wird er
also künftig für seine Hobbys haben: die Fotografie, die Kunst, das Golfen sowie seine umfangreiche Sammlung von Exponaten rund um das Bier - mit allein über 1200 Plakaten. Und häufiger wird er künftig seine Frau Angela, die als
Reiseführerin arbeitet, auf ihren Touren begleiten - wie zuletzt nach Birma und Jordanien. In der Geschäftsführung der Gaffel-Brauerei am Kölner Eigenstein, die er nach seinem Studium der Brauerei- und Getränketechnologie mit seinem Bruder Johannes 1972 - nach dem plötzlichen Tod des Vaters - übernommen hatte, wird Heinrich Becker aber ,,wohl noch zwei bis drei Jahre" bleiben. Die Führung an seinen Sohn Heinrich-Philipp (37) übergeben, wie er es eigentlich geplant hatte, das mag er nun doch nicht. Angesichts der Turbulenzen im eigenen Unternehmen möchte er seinen Sohn in der Geschäftsführung ,,nicht allein lassen", sagt Becker.
Seitdem Johannes Becker (63) 2007 aus der Geschäftsführung der Brauerei ausgeschlossen worden war, führen die Brüder einen gerichtlichen Dauerkrieg: l7 Verfahren waren es bis Ende 2012. Es geht dabei um Vorwürfe wie Spesenbetrug, unzulässige Privatentnahmen, Bilanzfälschung, Miss-Management, Kreditbetrug oder Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Gegenseitig forderten die Brüder vor Gericht, den jeweils anderen als Gesellschafter auszuschließen - was bislang stets misslang.
Immer noch droht der Gaffel-Brauerei wegen der anhaltenden Streitigkeiten die gerichtlich angeordnete Auflösung wegen Zerrüttung der Gesellschafter und der anschließende Verkauf an den meistbietenden Interessenten.
Dann wäre es womöglich vorbei mit der über 100-jährigen Ara der Familie Becker als Eigentümer von Gaffel. Heinrich Becker hält allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass die Brauerei zwangsweise aufgelöst wird, für ,,sehr gering". Für Gaffel sei 20l2,,das beste Jahr des Bestehens" gewesen, das Unternehmen floriere - auch dank des in diesem Umfang wohl nicht erwarteten Erfolgs der von Gaffel eingeführten alkoholfreien Fassbrause. Von ,,Missmanagement" könne keine Rede sein. Er hoffe, dass der Antrag seines Bruders auf Auflösung vom Oberlandesgericht spätestens im Sommer abgelehnt wird. Dass Johannes Becker aber auch dann keine Ruhe geben
werde, sei ihm klar. Seinen Bruder macht Heinrich Becker auch für die Anzeige verantwortlich, aufgrund derer das
Kartellamt gegen mehrere Kölsch-Brauer - darunter neben Gaffel auch Früh, Reissdorf und die Erzquell-Brauerei (Zunft-Kölsch) - Ermittlungen wegenverbotener Preisabsprachen eingeleitet hatte. Nachdem es Ende 2011 Durchsuchungen bei den betroffenen Brauereien gab, sei es in diesem Verfahren inzwischen ,,absolut ruhig" geworden, sagt Heinrich Becker. Das trifft für den Verband Rheinisch-Westfälischer Brauereien allerdings weniger zu. Hier soll es in der Amtszeit von Heinrich Becker zu ,,wettbewerbsbeschränkenden Absprachen" gekommen
sein, berichtete vergangenen Monat der ,,Focus". Heinrich Becker hat aber eine einstweilige Verfügung gegen die Behauptung des Magazins erwirkt, Becker habe die entsprechenden Sitzungen des Wettbewerbsausschusses geleitet. Dass Heinrich Becker trotz allem noch lachen kann, zeichnet den Lokalpatrioten aus. Der vor den Gerichten öffentlich ausgetragene Streit mit seinem Bruder habe der Marke überhaupt nicht geschadet, meint er. Nach wie vor gehört Gaffel mit Reissdorf und Früh zu den drei großen Privatbrauereien in der Stadt. Und nach
seinem Motto für die Zukunft befragt, nennt er einen Paragrafen des kölschen Grundgesetzes: ,,Et hätt noch emmer joot jejange... Das behaupten nach jeder Katastrophe allerdings immer nur die Überlebenden.
"Rewe lässt Richmodis auferstehen"
Online-Artikel auf www.schillmalz.com
29. November 2012
Totgesagte leben länger: Die Rewe-Gruppe vertreibt seit dieser Woche exklusiv Richmodis Kölsch in ihren Märkten in Köln, im Bergischen Land, im Rhein-Erft-Kreis sowie im Raum Koblenz. Markeninhaber und Chef der Privatbrauerei Heinrich Becker erzürnt mit dem Deal um diese schon eingestampfte Marke seine Kollegenbrauer vom exklusiven Kösch Convent. Diese befürchten nun eine neue Preisschlacht, die den sonst eher geschützten Kölschmarkt erzittern lassen könnte. Zudem erinnert das umgestaltete Flaschenetikett ob gewollt oder ungewollt durch die neue rote (statt ehemals grüne) Farbe stark an den Marktführer Reissdorf. Thomas Bonrath, Sprecher der Rewe-Gruppe, ist jedenfalls stolz auf seinen Coup: „Wir sind stolz darauf, als Kölner Unternehmen dieses traditionsreiche Kölsch wieder auferstehen zu lassen“.
Die Wiederauferstehung von den Toten dürfte im Grunde keinen Kölner verwundern, da auch die Namenpatronin Richmodis, eine Kölner Adlige aus dem 14. Jahrhundert, der Sage nach vom Pesttod auferstand. Nachdem die Untote vom Friedhof nach Hause kam und der Hausknecht dem Gatten die frohe Kunde von der wieder auferstandenen Richmodis verkündete, soll dieser gesagt haben, eher würden seine beiden Pferde den Turm ersteigen und den Kopf zum Fenster hinausstrecken, als dass seine geliebte Frau noch leben würde. Doch genau das passierte dann. Und zur Erinnerung sieht man noch heute in der Kölner Richmodstraße den Turm, aus dessem Fenster zwei Pferdeköpfe schauen.
Die Privatbrauerei Gaffel erwarb im Jahr 1998 die ehemals rund 70.000 hl starke Richmodis-Brauerei von der Königsbacher Brauerei in Koblenz. Die früheren Besitzverhältnisse erklären auch, warum die Marke Richmodis bis zum Schluss fast nur noch als Fassbier im Koblenzer Raum verkauft wurde. Vor zehn Jahren, im Jahr 2002 wurde die Marke dann eingestellt und erlebt nun als exklusive Handelsmarke der Rewe-Gruppe ihr Comeback. Gebraut wird das Bier wieder in der ehemaligen Richmodis-Braustätte in Köln-Porz.
"Landgericht weist Gaffel-Klage ab"
Artikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger von Evelyn Binder
Köln. Im Bruderstreit der Gaffel-Gesellschafter Johannes und Heinrich Becker ist Heinrich in einer wichtigen Klage unterlegen: Vor dem Landgericht Köln wollte er den Ausschluss seines Bruders Johannes als Gesellschafter erwirken, der noch mit 38 Prozent an dem Unternehmen beteiligt ist. Das Landgericht wies die Klage mit einem Streitwert von 2,5 Millionen Euro nun aber ab. Selbst wenn die Vorwürfe begründet wären, rechtfertigten sie nicht einen Ausschluss, hat das Landgericht entschieden. Die beiden Brüder tragen ihren Streit um die Macht bei Gaffel seit der Absetzung von Johannes Becker als Geschäftsführer durch Heinrich vor gut sechs Jahren öffentlich aus. Heinrich Beckers Familie hält 62 Prozent der Anteile. Insgesamt standen und stehen sich die Brüder in 17 Gerichtsverfahren als Kontrahenten gegenüber. In diesem Fall, der nun vor dem Landgericht verhandelt wurde, hatte Heinrich Johannes vorgeworfen. Geschäftsgeheimnisse an ein Wirtschaftsmagazin weitergegeben zu haben. Er habe dort zudem neue Vorwürfe wie etwa den des Kreditbetrugs erhoben. Zudem soll Johannes Becker Kartellamtsermittlungen angestoßen haben. Er habe mit seinem Verhalten der Firma geschadet, so der Vorwurf. Doch der Ruf des Unternehmens war nach Auffassung des Landgerichts längst ramponiert: Durch den öffentlichen Streit sei bereits so viel Porzellan zerschlagen worden, dass durch den Magazinbericht der "negative Eindruck nicht noch mehr vertieft werden konnte", so das Landgericht. Das Gericht sieht für die Umstände zudem eine erhebliche Verantwortung, wenn nicht sogar eine überwiegende Mitverantwortung des Klägers. "Für uns ist die Entscheidung des Landgerichts ein großer Erfolg", sagte Rechtsanwalt Michael Falter, der Johannes Becker vertritt. Die Gegenseite hingegen kann die Entscheidung nicht nachvollziehen: ,,Das Gericht geht von einem falschen Sachverhalt aus", sagte Heinrich Beckers Anwalt Ralph Drouven, und die rechtliche Würdigung sei zum Teil fragwürdig. Er kündigte an, umgehend in Berufung zu gehen. ,,Das Urteil wird keinen Bestand haben", glaubt Drouven. Enden könnte der Streit in einer Auflösung der Gesellschaft, die die Gaffel-Brauerei betreibt. Die Brauerei könnte dann meistbietend verkauft werden. Das Oberlandesgericht hat dies in einem anderen Verfahren bereits als Option bezeichnet, wollte jedoch die Entscheidung des Landgerichts abwarten. Allerdings wollen beide Brüder an der Brauerei festhalten. Bei einem Bieterverfahren könnten auch Dritte Angebote abgeben. ,,Die Entscheidung des Landgerichts zeigt, dass jedenfalls Johannes Beckers Antrag auf Auflösung der Gesellschaft berechtigt war", sagt dessen Anwalt Michael Falter. Heinrich Beckers Rechtsbeistand Drouven kann sich ,,nicht vorstellen, dass die Gesellschaft aufgelöst wird".###
"Ein Ende mit schrecken?"
Artikel in der Kölnischen Rundschau von Hendrik Varnholt
Der Gaffel-Brauerei droht die Auflösung. Im
Bruderstreit der beiden Gaffel-Gesellschafter Heinrich und Johannes
Becker hat ein Senat des Oberlandesgerichts (OLG) Köln Sympathie für
einen entsprechenden Antrag erkennen lassen. Heinrich Becker ist
Mehrheitseigentümer der Brauerei. Johannes hält eine Minderheit an dem
Unternehmen. Die Brüder werfen sich seit Jahren gegenseitig Verfehlungen
vor. Der Vorsitzende des zuständigen OLG-Senats sprach gestern während
einer von den Brüdern angestrengten Berufungsverhandlung von „großer
Zerrüttung“. Er kündigte an, das Gericht werde über die Auflösung der
Gesellschaft beraten – „nach der Frage Ende mit Schrecken oder Schrecken
ohne Ende“.
Die Gaffel-Eigentümer streiten in mehreren Gerichtsverfahren
miteinander. In den Auseinandersetzungen geht es letztlich um das Sagen
über die Brauerei: Johannes Becker nimmt nicht hin, dass er im Jahr 2006
von seinem Bruder Heinrich und einem damaligen Mitgesellschafter als
Geschäftsführer abgesetzt worden war. In der Berufungsverhandlung vor
dem OLG ging es zudem um den Antrag von Johannes Becker, seinen Bruder
aus der Gesellschaft auszuschließen. Das Landgericht Köln hatte es im
vergangenen Jahr abgelehnt, Johannes wieder zum Geschäftsführer zu
machen. Es urteilte zudem gegen den Ausschluss von Heinrich. Der
Senatsvorsitzende am OLG machte nun deutlich, dass die Berufungsinstanz
ähnlich entscheiden dürfte. Johannes Becker aber hatte zudem
„hilfsweise“ die Auflösung der Gaffel-Brauerei beantragt. Die Frage
gewinne nun „eine zentrale Bedeutung“, sagte der Vorsitzende Richter.
Sollte es zu einem Auflösungsbeschluss kommen, dürfte Johannes Becker
dies als Zwischensieg werten. Er würde in dem Fall – wie alle übrigen
Gesellschafter – voraussichtlich zum Liquidator ernannt. Er hätte also
zunächst wieder Mitbestimmungsmöglichkeiten ähnlich denen eines
Geschäftsführers. Die Gaffel-Brauerei müsste nach Einschätzung von
Gesellschaftsrechtlern anschließend „in Geld umgesetzt“ werden: Sie
müsste meistbietend verkauft werden. Es könnten dann sowohl die
bisherigen Gesellschafter als auch fremde Interessenten zum Zuge kommen.
In Branchenkreisen heißt es, beide Becker-Brüder hegten Pläne, im Fall
einer Auflösung die Brauerei jeweils ohne den anderen Bruder zu
übernehmen. Heinrich und Johannes Becker sollen aus dem Grund mit
möglichen Partnern im Gespräch sein.
Der Vorsitzende des OLG-Senats gab den Brüdern gleichwohl zu bedenken,
ein Auflösungsbeschluss könne mit „erheblichen Nachteilen“ für das
Unternehmen verbunden sein. Er appellierte an die Parteien, sich zu
vergleichen: Er schlug vor, die „alte Generation“ könne sich zugunsten
der jungen zurückziehen. Heinrich und Johannes Becker aber ließen kaum
Bereitschaft zur Einigung erkennen. Der Rechtsanwalt von Johannes,
Michael Falter, sagte, die Auflösung sei „als Ultima Ratio der richtige
Weg“. Heinrich Beckers Vertreter argumentierten gegen die Auflösung.
Der OLG-Senat will am 13. Dezember eine Entscheidung verkünden – und in
seinen Überlegungen auch Vorwürfe berücksichtigen, die mit den
Preisabsprache-Untersuchungen des Bundeskartellamts (siehe Kasten)
zusammenhängen. Zuvor aber ist der Bruderstreit um die Gaffel-Brauerei
noch einmal am Landgericht Thema. In der nächsten Woche geht es dort um
einen Antrag von Heinrich Becker: Er wiederum will Johannes aus der
Gesellschaft ausschließen lassen.
"Brauer stehen zu Heinrich Becker"
Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger von Willi Feldgen
Weiteres Vorstandsmitglied ist Guido Bauer, Geschäftsführer des Haus Kölscher Brautradition in Mülheim (mit den Marken Sion, Gilden, Sester, Küppers, Peters, Kurfürsten). Haas hatte seinen Antrag damit begründet, dass sowohl er selbst als auch Heinrich Becker bereits „im Rentenalter“ seien und der Vorstand dringend verjüngt werden müsse, damit der Verband „zu alter Stärke und Dynamik zurückfindet“.
In diesem Zusammenhang hatte Haas vorab schriftlich mitgeteilt, dass auch er selbst „für eine weitere Amtszeit im Vorstand nicht mehr zur Verfügung stehe“. Daneben hatte er aber auch darauf hingewiesen, dass der erbitterte und immer wieder vor Gericht ausgetragene „Bruderkrieg“ zwischen Heinrich und Gaffel-Chef Johannes Becker dem Image der Sorte Kölsch insgesamt schade. Seinen Antrag konnte Haas den Brauern nicht persönlich erläutern, da er an der Versammlung „urlaubsbedingt“ nicht teilnehmen konnte.
Haas nannte noch einen dritten Grund für den Affront gegen Heinrich Becker: Zwei der drei Vorstände im Brauereiverband seien „heillos zerstritten“. Das bestätigt auch Heinrich Becker, der in diesem Streit den wahren Grund für den Angriff auf ihn sieht: Er habe sich nämlich entschieden gegen den Versuch von Haas gewehrt, den außerordentlichen Erfolg der Gaffel-Fassbrause mit einem ähnlichen Produkt und nahezu unveränderter Aufmachung zu kopieren. Seit eineinhalb Jahren befinde er sich deswegen mit Haas „im Clinch“.
"Kölsch gebraut in Australienr"
Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger
Doch in zwei Punkten irrt Wallman: Das „Four Pines“-Bier gibt es doch schon etwas länger, hergestellt wird es in einer kleinen Brauerei im wunderschönen Manly, sozusagen in Sichtweise des Pazifischen Ozeans. Das dort gebraute „Kolsch“ hat zudem mit unserem Nationalgetränk so gut wie nichts zu tun, es wird anders hergestellt, es hat einen „leichten“ Lemon/Lime-Geschmack und mit 4,6 Prozent einen ähnlich hohen Alkoholgehalt als Kölsch.
„Wir brauen eine ganze Reihe unterschiedlicher Biere“, sagt Sarah Turner, Event-Managerin von „Four Pines“. „Unser Kolsch basiert auf deutschem Rezept, wir bewerben Kolsch als ein German Style Ale.“ Viele deutsche Touristen kämen ins „Four Pines“ – „they love our beer!“ Beim „Kolsch“ habe man bewusst auf den Umlaut verzichtet, weil das echte „Kölsch“ halt aus Köln stamme.
Etwas weiter geht da die „Illawarra Brewery“ in Wollongong (50 Kilometer südlich von Sydney), sie nennt eines ihrer Biere „Koelsch“ und wirbt für ihr Koelsch mit dem ausdrücklichen Hinweis, es werde unter „kompletter Missachtung der Kölsch-Konvention“ gebraut.
Eigentlich eine Frechheit. Auch dieses Produkt schmeckt ganz anders, weil es mit Zitronen und Birnen versetzt ist. Der Kölner Brauerei-Verband betrachtet Nachahmer wie die „Four Pines Brewing Company“ und die „Illawarra Brewery“ mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Das zeigt doch nur, wie beliebt und bekannt unser Kölsch in aller Welt ist“, sagt Geschäftsführer Adolf Andörfer. „Auch aus Kostengründen können wir aber nicht dagegen vorgehen“ – die „geografisch geschützte Angabe“ (ggA) gelte nur für Europa. „Wenn diese Brauereien allerdings ihr Kolsch oder Koelsch in Europa vertreiben wollten – dann gehen wir gnadenlos gegen sie vor.“
Das sollte aber keinen Reisenden davon abhalten, „Kolsch“ im Gasthaus „Vier Pinien“ an der East Esplanade in Manly zu ordern. Wer jemals in Sydney war, weiß die halbstündige Fahrt mit der Fähre vom Circular Quay nach Manly als unglaublich schönes – und jederzeit wiederholbares – Erlebnis zu schätzen. Und da bietet es sich an, vor der Rückfahrt ein Kolsch zu trinken: Cheers, Mates!
"Letztes Kurfürsten Kölsch im Gequetschten gezapft"
Artikel im Bonner General-Anzeiger
Nachdem bereits Mitte 2011 die Produktion von Richmodis Kölsch eingestellt wurde war auch für Kurfürsten Kölsch am 31.12.2011 das lang erwartete Ende da.
Das Ende von Kurfürsten Kölsch beschreibt der nachfolgende Artikel aus dem Bonner General Anzeiger.
Bonn. Das Jahr 2011 ist vergangen, und mit ihm ist eine 321 Jahre alte kurfürstliche Brautradition in Bonn verschwunden.
Kurfürsten Kölsch, gleichermaßen geliebt und geschmäht, ist mit dem Jahreswechsel eingestellt worden (der GA berichtete). Ein letztes Mal trafen sich Stammgäste und Kurfürstenliebhaber am Samstag in der Gaststätte "Zum Gequetschten", um bei frischgezapftem Kurfürsten Kölsch beisammen zu sitzen. Tief im Braukeller der Gaststätte wurden die letzten Fässer des bis 1993 in der Bornheimer Straße gebrauten Bieres angeschlossen.
Seit 26 Jahren gibt es die Gaststätte "Zum Gequetschten" in ihrer heutigen Form, 26 Jahre wurde dort Kurfürsten Kölsch ausgeschenkt. "Es ist schon schwer, sich nun zu verabschieden. Kurfürsten ist ein leckeres und gutes Bier", sagte die Gequetschten-Geschäftsführerin Karola Scholz.
Umstellung auf Gilden-Kölsch.
Selber habe sie es immer sehr gerne getrunken. Mit dem Jahreswechsel stelle man den Ausschank nun auf Gilden-Kölsch um. "Es ist ein bisschen herber, kommt mit seinem Geschmack an das Kurfürsten Kölsch ran und wird unseren Gästen sicher auch schmecken, aber schade ist es trotzdem", so Scholz.
"Seitdem ich 1965 nach Bonn gekommen bin, habe ich immer gerne Kurfürsten Kölsch getrunken", sagte der Gast Rolf Walter. bedauernd. "Man fand es in den letzten Jahren nicht mehr so leicht, nur noch wenige Gaststätten schenkten es aus, aber mir hat es vom Geschmack her sehr gut gefallen." Mit einem festen Freundeskreis habe man sich im Gequetschten auf ein Kurfürsten getroffen.
Stück Bonner Geschichte geht zu Ende.
"Man verbindet viele Erinnerungen mit diesem Kölsch", sagte Walter. Erst an den Weihnachtstagen habe er seinem Enkel den Standort der alten Brauerei auf der Bornheimer Straße gezeigt. Ein Stück Bonner Geschichte gehe mit dem Bier verloren.
Auch an der Fassade der Traditionsgaststätte wird sich das Aus für Kurfürsten Kölsch bemerkbar machen. Am Neujahrstag blieb die Gaststätte geschlossen, pünktlich zum Ausschank des neuen Kölschs werden auch die Brauerei-Ausschankschilder abgebaut sein, kündigte Scholz an.
Aus beinahe allen verbliebenen 31 Kurfürsten Ausschankstellen ist zum Jahreswechsel das Kurfürsten Kölsch verschwunden. Allein im Lokal "Sonjas", Friedrichstraße 13, wird es noch einmal eine Möglichkeit geben, sich vom Kurfürsten Kölsch zu verabschieden. Für die Feier ihres 25. Jubiläums am 9. Januar hat sich Wirtin Sonja Reuel einige Fässer zur Seite gestellt.
"Kartellamt nimmt Kölner Brauereien ins Visier"
Artikel im Handelsblatt von Christoph Kapalschinski
Die rheinischen Kölsch-Brauer sollen ihren eigenen Ausweg aus dem Dilemma gefunden haben, vermutet das Bundeskartellamt. Sie sollen über Jahre hinweg Preise abgesprochen haben.
Ende vergangener Woche durchsuchten 25 Mitarbeiter der Bonner Behörde sowie 15 Polizisten fünf Brauereien und eine Privatwohnung.
Anlass soll der Tipp eines Kronzeugen gewesen sein. Den möglichen Kartellbrüdern droht eine Strafe von bis zu zehn Prozent des Umsatzes. In fast allen Fällen komme es nach Durchsuchungen zu einer Strafe, allerdings gelte zunächst die Unschuldsvermutung, hieß es beim Bundeskartellamt.
Die betroffenen Kölsch-Brauereien wehrten sich gegen den Vorwurf. „Wir halten das nicht für gerechtfertigt“, sagte Dirk Heisterkamp, Verkaufsleiter bei der Brauerei Früh, dem Handelsblatt. „Es herrscht ein beinharter Wettbewerb.“ Zum einen konkurrieren die Brauereien bei Lieferverträgen mit den Brauhäusern in Köln und Umgebung.
Zum anderen gehen die Flaschen in den Einzelhandel. Dort stehen sie in Konkurrenz zu den Pils Bier Angeboten – vor allem bei der Platzierung als Sonderangebot. Dennoch ist Kölsch in der Regel zwei bis drei Euro pro Kasten teurer. Das gilt jedoch auch für andere regionale Spezialitäten wie Weizenbier. Gastronomen hingegen zahlen in etwa die gleichen Preise für alle Sorten. Kölsch, meist in 0,2-Liter-Gläsern ausgeschenkt, kostet derzeit in Köln etwa 1,70 Euro je Glas.
Trotz Versuchen, das Bier bundesweit auszuliefern, blieb der Kölsch-Markt regional auf Köln und Umgebung begrenzt. Schon im benachbarten Düsseldorf beherrscht das regionale Alt-Bier den Markt, 2011 ging der Kölsch-Absatz hier sogar zurück. Das Ruhrgebiet hingegen trinkt traditionell Pils oder Export-Bier. Selbst in Nordrhein-Westfalen kommt Kölsch so nur auf einen Marktanteil von 7,7 Prozent. Allein in Rheinland-Pfalz liegt Kölsch noch über einem Prozent. In allen anderen Bundesländern ist der Absatz fast nicht messbar und liegt sogar noch unter dem des marginalisierten Alt-Biers. Zwar soll der Kölsch-Absatz in diesem Jahr nach Branchen-Schätzungen leicht steigen, allerdings ist er in den vergangenen zehn Jahren um rund 20 Prozent geschrumpft. Märkte mit sinkenden Absatzmengen und hohem Wettbewerbsdruck gelten als anfällig für Kartelle.
Zwist im Kölschen Klüngel
Die Früh-Brauerei mit der drittgrößten Kölsch-Marke verweist darauf, dass es seit 2005 lediglich zwei Preiserhöhungen gegeben habe. „Wir wollen versuchen, 2012 Preiserhöhungen zu vermeiden, obwohl sie nötig werden“, sagte Heisterkamp. Früh macht inklusive dreier Brauhäuser rund 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Marktführer ist Reissdorf, wichtiger Spieler außerdem die Radeberger-Gruppe mit dem Kölner Verbund, der nicht durchsucht wurde. Insgesamt gibt es 23 Marken.
Einige Brauereien haben bereits Preiserhöhungen angekündigt, auch der Kölner Brauerei-Verband hatte angedeutet, dass Preiserhöhungen nötig werden könnten. Die Brauer bemängelten bislang, der Handel gebe höhere Preise nicht an die Kunden weiter.
Das Kartellamt ermittelt auch auf dem Pils-Markt. In einer Branchenuntersuchung will die Behörde herausfinden, ob einzelne Brauer mit dem Handel Preise absprechen. Im aktuellen Kölsch-Fall hingegen geht es um mögliche Absprachen zwischen den Herstellern.
Die Ermittlungen sind nicht die einzigen Schlagzeilen, die die Branche produziert. Zuletzt hatte ein Bruderzwist den Bier-Klüngel in Atem gehalten. Im Mittelpunkt stand die Gaffel-Brauerei, die ebenfalls durchsucht wurde. Die Inhaber-Brüder Heinrich und Johannes Becker streiten seit Jahren – erst um die Strategie, zuletzt mit juristischen Mitteln um angebliche Bilanzfälschungen.
"Johannes Becker will Gaffel-Brauerei auflösen"
Artikel im Kölner Express von Bastian Ebel
Paukenschlag im Bruder-Streit zwischen den Gaffel-Brüdern Heinrich und Johannes Becker: Johannes Becker fordert jetzt den Verkauf der Gaffel-Brauerei, um den Streit zwischen den Parteien endgültig zu beheben.
„Das Vertrauen zwischen den Gesellschaftern ist beidseitig zerrüttet“, bestätigt Anwalt Michael Falter den Antrag vor Gericht, die Gesellschaft Privatbrauerei Becker & Co. OHG auflösen zu wollen, falls das Gericht Heinrich und seinen gleichnamigen Sohn nicht als Gesellschafter ausschließt.
„Es wäre für beide Seiten ein guter Schritt, weil der Meistbietende nachher die Firma zurückkaufen könnte“, so Falter. „Damit wäre der Streit zwischen den Brüdern zumindest aus Firmensicht beendet.“
Im September hatte Johannes Becker erfolgreich geklagt, dass die geschäftsführenden Gesellschafter, Heinrich Becker und sein Sohn, den Jahresabschluss 2010 aufstellen und aushändigen müssen.
Der Antrag auf Auflösung der Brauerei sei „aussichtslos“, konterte Heinrich Becker jr. Die Entscheidung werde sich erübrigen, da „eine Ausschlussklage gegen Johannes Becker wegen grob gesellschaftsschädigenden Verhaltens eingereicht worden ist“.
"Die fabelhaften Becker-Boys"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Willi Feldgen
Der Rechtsstreit der Gaffel-Brüder Johannes und Heinrich Becker ist - vorerst - beendet.
KÖLN - Vier Jahre hat ihre Auseinandersetzung vor dem Kölner Landgericht gedauert – nun wurde am Freitag ein Urteil verkündet: Die Klage von Gaffel-Brauer Johannes Becker (61) gegen seinen Bruder, Gaffel-Brauer Heinrich Becker (64), wird abgewiesen, und der Kläger muss die kompletten Gerichtskosten tragen (Az.: 89 0 4/07). Damit gilt: Johannes Becker, Minderheitsgesellschafter der Gaffel-Brauerei mit einem Anteil von 38 Prozent, ist als Geschäftsführer des Familienunternehmens abgesetzt.
Vorausgegangen war ein erbittert geführter Streit: Im Jahr 2007 hatten seine Mitgesellschafter Johannes Becker wegen Differenzen über die Geschäftsstrategie der Brauerei als Geschäftsführer abgesetzt. Vor Gericht klagte dieser aber auf seine Wiedereinsetzung – und gleichzeitig auf Abberufung seines eigenen Bruders aus der Geschäftsführung.
Mammutprozess mit 45 Zeugen.
Sein Vorwurf lautete auf Spesenbetrug. Heinrich Becker, der damals ebenfalls 38 Prozent an der Brauerei hielt, seinen Anteil Mitte 2008 aber auf 62 Prozent ausbauen konnte, habe in erheblichem Umfang Privatausgaben als Geschäftskosten abgerechnet und damit Vermögen der Brauerei veruntreut. In einer Widerklage erhob Heinrich Becker aber genau dieselben Vorwürfe gegenüber seinem Bruder.
Schon beim „Gütetermin“ im November 2007 hatte Frank Czaja, Vorsitzender Richter der 9. Kammer für Handelssachen, die verfeindeten Brüder aufgefordert, sich im Interesse ihres Unternehmens außergerichtlich zu verständigen. Aber dazu kam es nicht, und so wurden in vier Jahren 45 Zeugen vernommen: Geschäftspartner, Getränkegroßhändler, Brauereichefs, ein Verlagsgeschäftsführer, die Geschäftsführer des Kölner Brauerei-Verbands und des Deutschen Brauerverbands, Gaffel-Angestellte und hochrangige Mitarbeiter von Kölner Banken mussten vor Gericht aussagen.
Ungewöhnliche Abrechnungen.
Was dabei zutage trat, war erstaunlich: Hunderte von angeblichen Geschäftsessen in zum Teil noblen Kölner Restaurants wie bei „Luciano“, im „Excelsior“, im „Hasen“, bei „Da Marco“ oder im „Golfclub Lärchenhof“ – zum Teil sogar an Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester – hatten tatsächlich nicht mit den auf den Bewirtungsbelegen aufgeführten Gästen stattgefunden. Es gab sogar eine zeitgleiche Abrechnung für ein Geschäftsessen in New York und eines in Köln. Private Handy-, Reise- und Tankkosten waren auf Kosten der Brauerei abgerechnet worden; von Gaffel-Mitarbeitern wurden Arbeiten an den Häusern der Brauerei-Gesellschafter erledigt, das Schwimmbad abgedichtet, die Garage verputzt, die Hunde gehütet oder die Porsches betankt. Ein Brauerei-Fahrer brachte dem Sohn eines Gesellschafters frisches Gaffel-Kölsch für eine Party nach Paris, fuhr eine Becker-Tochter in ihre neue Wohnung nach Mailand oder organisierte private Umzüge von Berlin nach Köln und Koblenz.
Für das ungewöhnliche Abrechnungsgebaren interessierte sich bald auch der Fiskus, weil nur echte Geschäftsausgaben steuerlich begünstigt werden, nicht dagegen Privatausgaben, die als geschäftliche abgerechnet werden. Nach einer Selbstanzeige hat zumindest Heinrich Becker Rückzahlungen in ungenannter Höhe an das Unternehmen und an das Finanzamt geleistet.
Keine Entscheidung über mögliche Revision
Das Fehlverhalten der Brüder exakt gegeneinander aufzurechnen, darauf verzichtete Czaja in seinem Urteil, das den Parteien im Wortlaut erst am Montag zugestellt wird. Die Verfehlungen seien aber auf beiden Seiten gravierend gewesen. Es sei daher nicht zu rechtfertigen, den Gaffel-Geschäftsführer Heinrich Becker ab- und seinen Brüder Johannes wieder einzusetzen. Somit werde bei Gaffel alles bleiben wie es ist.
„Wir freuen uns darüber, dass das Landgericht unserer Auffassung gefolgt ist“, kommentierte Heinrich Becker das Urteil. „Ich hoffe, dass mein Bruder nunmehr einsieht, dass eine konstruktive Zusammenarbeit unter Gesellschaftern weiterführt als sinnloses Prozessieren.“
Ein Anwalt von Johannes Becker teilte mit, man werde die Urteilsgründe prüfen und entscheiden, ob man Revision vor dem Oberlandesgericht einlegt. Dort war Johannes Becker jedoch schon mal mit dem Versuch gescheitert, seine Abberufung als Geschäftsführer zu revidieren.
---------------
Kommentar zu Gaffel - Mutwillig den Ruf ruiniert (von Willi Feldgen).
Der langjährige Rechtsstreit der Gaffel-Brüder Johannes und Heinrich Becker hat sowohl der Finanzkraft der Brauerei als auch dem Renommee der Marke geschadet. Der nun vor dem Landgericht unterlegene Johannes Becker wäre gut beraten, die Sache nun ruhen zu lassen.
Der Rechtsstreit der Gaffel-Brüder Johannes und Heinrich Becker ist - vorerst - beendet.
Dass sich die beiden Becker-Brüder, Inhaber der Gaffel-Brauerei, eine öffentliche Schlammschlacht vor Gericht lieferten, hat auch viele Wettbewerber aus der Branche entsetzt. Und die bisherige Auseinandersetzung hat der Marke Gaffel – immerhin eine der drei großen Kölsch-Marken in der Stadt – natürlich nicht genutzt.
Ganz im Gegenteil: Das Verfahren hat gezeigt, dass beide Gesellschafter in den vergangenen Jahren nicht zimperlich waren, wenn es darum ging, sich privat veranlasste Ausgaben vom eigenen Unternehmen bezahlen zu lassen. Diese Selbstbedienungsmentalität schwächte nicht nur die Finanzkraft der Brauerei, sondern reduzierte auch die Steuerbelastung – und schädigte damit die Allgemeinheit.
Wiederholt hatten in den zurückliegenden Jahren Kölner Richter die Prozessbeteiligten fast schon flehentlich aufgerufen, sich doch möglichst außergerichtlich zu einigen und damit Schaden von der Gesellschaft und dem eigenen Renommee abzuwenden. Doch diese Versuche blieben erfolglos.
Sicher war es nicht klug, den Gaffel-Gesellschafter Johannes Becker seines Postens als Brauerei-Geschäftsführer zu entheben. Andererseits war es – gelinde gesagt – blauäugig von ihm, angesichts seiner im Verfahren auch offensichtlich gewordenen Verfehlungen verbissen um seine Wiedereinsetzung zu kämpfen: Dieser Schuss ist jedenfalls nach hinten losgegangen.
Johannes Becker ist mit seiner Klage auf ganzer Linie gescheitert. Er wäre wohl gut beraten, nun nicht aufs Neue dickköpfig in die nächste Instanz zu ziehen.
"Der Kölner Bier-Streit der DuMonts"
Online-Artikel aus Meedia.de
Dies ist eine typische Kölner Geschichte mit Kölsch, Karneval und dem Pressehaus M. DuMont Schauberg. Die Getränke-Zeitschrift Inside hat berichtet, dass Verlegersohn Konstantin Neven DuMont (u.a. Express, Frankfurter Rundschau, Berliner Zeitung) mit einer einstweiligen Verfügung gegen die kleine Kölner Privatbrauerei Sünner vorgegangen ist. Grund: Sünner wollte ein DuMont Kölsch auf den Markt bringen. Die Brauereichefin trägt zufällig den gleichen Namen wie das Zeitungshaus. Das sorgt für Streit.
Die Brauerei Sünner in Köln-Kalk ist ein eher kleiner Spieler im lukrativen Biergeschäft. Wohl auch darum versucht der Brau-Zwerg des öfteren mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam zu machen. So ebnete Sünner sehr zum Ärger der alteingesessenen Kölsch-Brauereien der Billigmarke Traugott Simon Kölsch den Weg in die Domstadt.
Nachdem sich die Sünner-Seniorchefin Ingrid Müller-Sünner in den Ruhestand verabschiedet hat, wollte nun offenbar deren Tochter und geschäftsführende Gesellschafterin Astrid Schmitz-DuMont eigene Duftmarken setzen und unter dem Namen DuMont Kölsch eine junge neue Biermarke in trendiger Weißglasflasche auf den Kölner Biermarkt bringen.
Allerdings bekam das auf Traditionen bedachte Zeitungshaus M. DuMont Schauberg Wind von der Sache und erwirkte eine einstweilige Verfügung. Die Bier-Pläne von Sünner wurden vorerst gestoppt. Laut Inside sieht Jungverleger Konstantin Neven DuMont die Markenrechte seines Hauses in Gefahr. Konstantin Neven DuMont ist in Köln gut vernetzt. So sitzt er u.a. dem Aufsichtsrat des Karnevalsvereins Goldene Jungs e.V. vor, dessen Mitglieder honorige Stadt-Persönlichkeiten sind, die Spenden sammeln und verteilen und während der tollen Tage dem jecken Treiben in goldenen Anzügen beiwohnen.
Im Vorstand der Goldenen Jungs sitzt praktischerweise auch Heinrich Philip Becker, Chef der Kölner Traditions-Kölsch-Brauerei Gaffel, so dass man in Goldene-Jungs-Kreisen über die örtlichen Bier-Vorgänge stets im Bilde sein dürfte.
Astrid Schmitz-DuMont trägt den in Köln klingenden Namen DuMont, weil sie mit dem Rechtsanwalt Ulrich Schmitz-DuMont verheiratet ist. Der hat zwar nichts mit den Zeitungs-Zaren vom Rhein zu tun, aber als seine anwaltlichen Schwerpunkte gibt er u.a. Markenrecht, Wettbewerbsrecht und Urheberrecht an. Es bleibt alles irgendwie doch alles in der Familie.
"Aus der Traum vom eigenen Kölsch
Brauhaus Freischem's macht dicht"
Artikel aus dem Express von Hendrik Pusch
„Es hat nicht sollen sein“, sagt der enttäuschte Wirt dem EXPRESS. Knapp eine Million Euro hat er in die Renovierung des ehemaligen „Weißbräu“ gesteckt, die Technik erneuert, den Sudkessel aufpoliert. 20 Hektoliter sollten daraus im Jahr fließen. „Vergangenen Samstag habe ich gemerkt, dass mir der Laden aus dem Ruder läuft.“
Zwölf Mitarbeiter mussten bezahlt werden, dazu eine Pacht von 13.500 Euro pro Monat – der Vertrag war auf 15 Jahre angelegt. „Der Vermieter war keine große Hilfe, ich musste alles selbst finanzieren, etwa die Lüftung, die 60.000 Euro verschlungen hat.“
In der Karnevals-Session herrschte noch Hochbetrieb im Brauhaus, danach blieben die Gäste aus. „Ich hab's mit Angeboten probiert, fünf Gerichte für unter zehn Euro auf der Karte gehabt. Es hat nichts gebracht“, sagt Freischem.
Was bleibt ist ein riesiger Schuldenberg, für den der Wirt mit seinem Privatvermögen haftet. „Die Lieferanten sind verständnisvoll. Ich werde alles dafür tun, jede Rechnung zu begleichen.“
Manni Freischem bleibt das Sünner Brauhaus Walfisch in der Salzgasse, das er seit elf Jahren erfolgreich betreibt. Und das soll auch so bleiben. „Wer einmal falsch parkt, hat doch das Autofahren nicht verlernt“, lacht Freischem mit reichlich Galgenhumor.
"Freischems Hausbrauerei
Neues Brauhaus, neues Kölsch"
Artikel aus dem Express von Volker Roters
Mit überschaulicher Größe: 2.500 Hektoliter Bier will die neue Freischems Hausbrauerei am Weidenbach auf den Markt bringen.
Schräg gegenüber von St. Pantaleon hat Manni Freischem, selbst ein Roter Funk, das ehemalige „Weiss Bräu“ innerhalb weniger Monate für mehr als eine Million Euro umgebaut.
27 Tage lagert das Kölsch in den Edelstahl-Gärtanks, überwacht von Jung-Braumeister Benedikt Ott. Er ist stolz auf seinen Job: „Ich habe bei Sünner gelernt.“ Der Hopfen kommt aus der Hallertau, das Malz aus Hürth.
Am 1. Oktober geht es los, neben mehreren Sälen gibt es auch eine Dachterrasse. Das hauseigene Kölsch kostet 1,40 Euro, auf der Fooderkaat geht es ab 9 Euro los. Die klassische Mitternachtsruhe im Brauhaus hat Freischem abgeschafft.
Wer bis 4 Uhr weiter trinken will, kann das im Keller tun. Bei Musik und Qualm im Raucherkeller. Neben Kölsch werden noch vier andere selbst gebraute Sorten angeboten: Weizen, Trüb, Schwarzes und Kleines Schwarzes. Wer auf Alkohol verzichtet, kann zumindest Freischems Brauwasser trinken.
"Generationswechsel in der Malzmühle"
Artikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger von Willi Feldgen
KÖLN - Mit einem neuen Markenauftritt will die „Brauerei zur Malzmühle“ am Heumarkt in Köln Boden gutmachen. Von 2007 auf 2008 hatte die mit 151 Jahren älteste Kölsch-Brauerei einen Absatzrückgang von 44 000 auf 37 000 Hektoliter erlitten und war in die roten Zahlen gerutscht. Am gesamten Kölsch-Markt hält „Mühlen Kölsch“ einen Anteil von unter zwei Prozent. Die Familie Schwartz, der die Brauerei in vierter und fünfter Generation gehört, hatte daraufhin Anfang dieses Jahres mit Michael Rosenbaum einen externen Geschäftsführer zur Sanierung und Restrukturierung des Unternehmens eingestellt.
Dessen Analyse fiel wenig erbaulich aus: „Die Marke wurde nicht ausreichend gepflegt, der Vertrieb wurde vernachlässigt, und die Kosten wurden nicht an die verringerten Absatzmengen angepasst. Die Marke hat sich einfach zu lange auf ihrem guten Ruf ausgeruht.“ Rosenbaum steuerte dagegen: Für 13 der 26 Brauerei-Mitarbeiter wurde vor vier Monaten Kurzarbeit angemeldet, gleichzeitig wurde „mit einer erheblichen Investition“ das Sudhaus modernisiert und damit der Energieverbrauch um 40 bis 50 Prozent und der CO-Ausstoß um 70 Prozent gesenkt.
Im laufenden Jahr will Rosenbaum den Mühlen-Kölsch-Absatz auf dem Niveau des Vorjahres halten (bei einem insgesamt schrumpfenden Kölsch-Markt). In den beiden kommenden Jahren soll dann - mit einer durch natürliche Fluktuation verkleinerten Mannschaft - wieder das Niveau von 2007 erreicht werden. Mittelfristig strebt er 45 000 bis 50 000 Hektoliter pro Jahr an. Zum Vergleich: Reissdorf, Gaffel und Früh, die drei Marktführer in Köln, verkaufen jeweils mindestens zehnmal so viel Kölsch. Dafür ist Mühlen-Kölsch mit einem Preis von etwa 15 Euro pro Kasten das teuerste Kölsch überhaupt.
An der jahrzehntealten relativ plumpen 0,5-Liter-Euro-Flasche („Bauarbeiter-Flasche“) statt der inzwischen üblichen Langhals-Flasche hält die Malzmühle nach längeren internen Diskussionen fest. Die Neuanschaffung des erforderlichen Leerguts kostet die Brauerei zwar jedes Jahr einen fünfstelligen Euro-Betrag (weil die Flaschen etwa doppelt so teuer sind wie das Pfand von acht Cent), aber man will das Alleinstellungsmerkmal nutzen. Künftig erhalten die Flaschen allerdings - wie früher schon einmal - ein zusätzliches Hals-Etikett. Das Marken-Logo wird geändert: Die Schrift wird etwas schlanker, und das Logo wird in einen individuellen dreieckigen Rahmen gestellt. Nahezu untergegangen sei die Einführung einer neuen Clubflasche mit 0,33 Litern Inhalt, kritisiert Rosenbaum: „Die ist vor drei Jahren eingeführt worden und trotzdem kennt sie in Köln kein Mensch.“ Hierfür wird nun ein neues offenes Sixpack eingeführt, das die ungewöhnliche Form der Flasche deutlicher als bisher herausstellt.
Um den Absatz anzukurbeln, soll „Mühlen-Kölsch“ künftig stärker im Getränkefachgroßhandel und im höherwertigen Lebensmitteleinzelhandel (etwa bei Rewe und Edeka) vertreten sein. Außerdem soll der Vertrieb in der Gastronomie ausgebaut werden - bisher wird die Marke in 150 Gaststätten im Großraum Köln ausgeschenkt. In den vergangenen vier Monaten seien bereits zehn Gaststätten dazugekommen, sagt Rosenbaum - verloren habe man als Absatzstätte allerdings den „Em goldene Kappes“ in Nippes - ein wichtiges Standbein.
Als Interims-Geschäftsführer eingestellt
Rosenbaum ist von Josef Schwartz, der sich inzwischen aus Gesundheitsgründen von der Unternehmensführung zurückgezogen hat, als Interims-Geschäftsführer eingestellt worden. Übernehmen wird das Unternehmen in einigen Jahren die fünfte Generation: Das sind die beiden Töchter Melanie Schnell (26) und Jennifer Schwartz (24). Beide studieren derzeit Betriebswirtschaft, Melanie plant ihren Abschluss für 2010 und will dann in der Brauerei die Bereiche Finanzen und Controlling übernehmen, während Jennifer sich auf Marketing und Vertrieb konzentrieren wird. Beide arbeiten auch jetzt schon im Unternehmen mit. Rosenbaum will die Verantwortung für die Malzmühle nach und nach auf die beiden dann geschäftsführenden Gesellschafterinnen übertragen und sich schrittweise wieder aus der Geschäftsführung zurückziehen. Dieser Prozess werde aber voraussichtlich noch einige Jahre dauern, sagt er.
"Das Kölsch fließt nicht mehr so flüssig"
Artikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger von Willi Feldgen
KÖLN - Das Rauchverbot in Esslokalen und die Wirtschaftskrise haben die
Kölsch-Brauer im vergangenen Jahr Umsatz gekostet. „Unser Ausstoß ging
2008 um 2,4 Prozent auf 2,18 Millionen Hektoliter zurück“, sagt der
Vorsitzende des Kölner Brauerei-Verbandes und Chef der Gaffel-Brauerei,
Heinrich Becker. Die Produktion der obergärigen Bier-Spezialität aus
Köln musste damit einen doppelt so großen Einbruch hinnehmen wie die
deutschen Brauer insgesamt. Deren Absatz ging 2008 um 1,1 Prozent auf
knapp 103 Millionen Hektoliter zurück.
„Trotzdem können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein“, sagt Axel Haas,
Vorstandsmitglied des Verbands und Chef der Erzquell-Brauerei (Zunft-Kölsch)
in Bielstein. Er begründet das mit dem wesentlich schlechteren
Abschneiden der Altbier-Konkurrenten, deren Produktion laut Statistik
des Brauereiverbandes NRW um fast acht Prozent einbrach. Vor wenigen
Jahren hatte Alt noch die Nase vorn. Inzwischen hält die Sorte in NRW
nur noch einen Marktanteil von 8,7 Prozent, Kölsch dagegen schon 16,4
Prozent. Insgesamt bleibt Pils aber mit gut 73 Prozent Marktanteil in
NRW die mit großem Abstand führende Biersorte. Becker und Haas
konstatieren jedoch genüsslich, dass die „großen Fernsehbiere“, wie sie
die stark beworbenen Pils-Marken Warsteiner, Krombacher, Bitburger und
König nennen, 2008 jeweils über drei Prozent und damit stärker verloren
hätten als der Kölsch-Markt. Offenbar hätten in Deutschland insgesamt
eher die kleineren regionalen Biermarken zulegen können. Auch Köln lebe
von der Vielfalt der lokalen Marken, sagen die Vertreter des Verbandes,
der in diesem Jahr seit 90 Jahren besteht.
Tatsächlich gibt es - auch ohne reine Handelsmarken - immer noch mehr
als 20 eingesessene Kölsch-Marken. Die starke Konzentration der
vergangenen Jahre hat allerdings dazu geführt, dass inzwischen schon 90
Prozent der Produktion aus lediglich fünf Braustätten kommen. Allein die
zum Oetker-Konzern gehörende Bergische Löwen-Brauerei in Mülheim
produziert Gilden, Sion, Sester, Küppers, Kurfürsten, Peters und - als
Lohnbrauer - auch Ganser-Kölsch.
Nischen zur AbrundungDie beiden großen Brauereien mit Mono-Marken sind
Reissdorf und Früh. Die Gaffel-Brauerei produziert neben ihrer
Hauptmarke auch Richmodis und Garde-Kölsch. Aus der Erzquell-Brauerei
kommen Zunft-Kölsch und außerdem für die Dom-Brauerei, die keine eigene
Braustätte mehr hat, auch deren Marken Dom, Giesler und Rats-Kölsch. Die
letzten zehn Prozent des Marktes entfallen auf Nischenprodukte wie
Mühlen, Päffgen, Sünner und Bischoff. Nicht im Verband sind die
Eigentümer der vergleichsweise winzigen Kölsch-Marken Hellers und
Stecken-Kölsch.
Interessant ist, dass sich 2008 auf dem Kölsch-Markt die Schere zwischen
Fass- und Flaschenbier öffnete. Der Absatz von Kölsch in Flaschen stieg
um ein Prozent, während das Fassbier um sieben Prozent einbrach. Nach
wie vor hat aber die Sorte Kölsch mit 42 Prozent einen erstaunlich hohen
Fassbieranteil.
Für das laufende Jahr erwarten die beiden Vorstandsmitglieder des
Kölsch-Verbandes eher einen weiteren Rückgang beim Bierausstoß insgesamt
und auch für ihre eigene Sorte. Dies gelte jedenfalls dann, wenn sich
die Wirtschaftskrise so fortsetze, wie das derzeit allgemein erwartet
werde. Einen Ausgleich könnte da nur ein besonders schöner Sommer
bringen, der für höheren Absatz sorgt - aber die Hoffnung darauf hat
sich in zurückliegenden Jahren schon zu oft getrogen als dass sich die
Brauer darauf noch verließen.
Hohe Erwartungen an alkoholreduziertes oder -freies Kölsch erfüllten
sich ebenfalls nicht: Am gesamten Kölsch-Ausstoß halten akoholfreie
Varianten einen Anteil von nur 0,6 Prozent und die alkoholreduzierten
gar nur 0,24 Prozent. Biermischgetränke mit Kölsch (und zum Beispiel
Cola) gibt es zwar, ihr Marktanteil liegt aber eher im Promillebereich.
"Gaffel-Mehrheit in einer Hand"
Artikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger von Willi Feldgen
KÖLN - „Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung
gegangen“, sagt Heinrich Becker über den überraschenden Deal mit seinem
Neffen Philipp. Dem hat er 24 Prozent der Gaffel-Anteile abgekauft und
hält damit nun 62 Prozent an der Kölsch-Brauerei: „Jetzt können wir mit
einer Stimme sprechen“, sagt er erleichtert. In den vergangenen Jahren
hatte es in der Führung von Gaffel erhebliche Probleme und
Reibungsverluste gegeben. Die verfeindeten Brüder Heinrich (61) und
Johannes Becker (58) machen sich gegenseitige Vorwürfe und tragen ihre
Streitigkeiten auch vor Gericht aus - der nächste Termin vor dem
Landgericht, zu dem diverse Zeugen aus dem Unternehmen und der Familie
als Zeugen geladen sind - ist für den morgigen Freitag vorgesehen.
Johannes - er hält 38 Prozent - war als Geschäftsführer von den beiden
anderen Anteilseignern abgesetzt worden. Er möchte nun vor Gericht
erreichen, dass auch sein Bruder abgesetzt wird und begründet das unter
anderem damit, dass Heinrich zum Nachteil des Unternehmens
Privatausgaben über den Betrieb abgerechnet habe. Ähnliche Vorwürfe gibt
es allerdings auch in der Gegenrichtung.
Die öffentlichen Auseinandersetzungen hatten dazu geführt, dass die
finanzierenden Kreditinstitute (Kreissparkasse, Sparkasse Köln / Bonn
sowie Kölner Bank) unruhig wurden und auf eine tragfähige Lösung des
Konflikts drangen. Bis vor kurzem galt deshalb auch ein Verkauf der
Brauerei an einen der großen nationalen Wettbewerber als Option für die
Zukunft von Gaffel. Mehrere Unternehmen gaben Gebote ab. Der höchste
Preis - angeblich rund 30 Millionen Euro - erschien den Eigentümern aber
als zu niedrig. Deshalb verschwanden die Verkaufpläne erst einmal wieder
in der Schublade.
Heinrich Becker sieht den Zwist inzwischen etwas gelassener als noch vor
wenigen Monaten: „Ich selbst bin ja ein Auslaufmodell“, sagt er
lächelnd. In den kommenden zwei Jahren will er die Geschäftsführung
sowieso abgeben - unabhängig davon, was die Gerichte entscheiden
sollten. Nach seinem Rückzug werden die Interessen der Eigentümer in der
operativen Leitung der Brauerei komplett von seinem Sohn Heinrich
Philipp (31) übernommen, der bereits seit September 2007 als
geschäftsführender Gesellschafter in dem Kölner Traditionsunternehmen
tätig ist, das seit exakt 100 Jahren der Familie Becker gehört. Den Kauf
der neuen Anteile habe er aus eigenen Mitteln bezahlt, sagt Heinrich
Becker. Einen Kredit habe er nicht aufnehmen müssen. Der Preis habe sich
am höchsten Kaufangebot für Gaffel orientiert. Für den Kauf verwendet
hat Heinrich Becker offenbar auch den Erlös aus dem Anfang Juni bekannt
gegebenen Verkauf seiner Anteile an den Kohlensäurewerken Carbo.
Mit der Mehrheit an der Brauerei Gaffel lassen sich nun aus Sicht von
Vater und Sohn strategische Pläne einfacher umsetzen: „Wir verdienen
zwar im Moment noch gut. Aber der Markt wird auch angesichts steigender
Rohstoff- und Energiekosten schwieriger und die Konkurrenz härter“, sagt
Heinrich Philipp Becker. Er glaube aber an die Marke und an die Zukunft
des Unternehmens. Gaffel müsse jedoch, um zu gleichen Preisen wie etwa
die wichtigsten Wettbewerber Früh und Reissdorf produzieren zu können,
langfristig seine Kosten senken, aber auch investieren. So werde die
Abfüllung - derzeit in Bilderstöckchen und Porz - auf Porz konzentriert.
Entsprechende Investitionen in eine neue Flaschenabfüllanlage, in
Technik und Infrastruktur sind dafür erforderlich. Den Banken seien
diese Pläne bereits präsentiert worden. „Sie haben von einem sehr
schlüssigen Konzept gesprochen“, sagt Heinrich Philipp Becker.
Langfristig sollen sogar Verwaltung und Produktion aus dem Eigelstein im
Kölner Zentrum an den Stadtrand nach Porz verlagert werden. Durch die
Zusammenlegung werde es „zwangsläufig zu betriebsbedingten
Freistellungen“ kommen, teilt die Brauerei mit. Die Rede ist von zehn
der derzeit 136 Mitarbeiter. „In erster Linie sind Arbeitnehmer
betroffen, die Anspruch auf Altersteilzeit haben haben“, sagt Becker.
Man bemühe sich mit dem Betriebsrat um eine sozialverträgliche Lösung.
In der Auseinandersetzung mit ihrem Bruder beziehungsweise Onkel hoffen
die geschäftsführenden Gesellschafter auf eine „Befriedung“. Es wäre
wünschenswert, sagt Heinrich Becker, wenn „das, was wir hier kompetent
erarbeitet haben, im Einvernehmen zum Wohl der Mitarbeiter, der Brauerei
und der Gesellschafter umgesetzt werden könnte“.
Die Gaffel-Brauerei ist mit einem Jahresausstoß von rund 50 Millionen
Litern die Nummer zwei in Köln - hinter Reissdorf und vor Früh. Im
laufenden Jahr (bis Ende Mai) sei der Absatz leicht um 0,8 Prozent
zurückgegangen, sagt Heinrich Becker. Das Minus der Kölschbrauer
insgesamt habe im selben Zeitraum 4,5 Prozent betragen.
"Das Kölsch läuft wieder"
Artikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger
KÖLN - Im Rechtsstreit der verfeindeten Brüder Johannes
und Heinrich Becker vor dem Kölner Landgericht pickte sich Richter Frank
Czaja am Freitag jedenfalls einige ganz besondere Termine heraus, an
denen es solche Geschäftsessen gegeben haben soll. Hintergrund: Die
Brüder werfen sich gegenseitig vor, auch Privatvergnügen auf Kosten der
Firma abgerechnet zu haben.
Seine Gäste will Johannes Becker - so ist es auf den bei der Brauerei
eingereichten Belegen notiert - unter anderem am ersten Weihnachtstag,
am zweiten Weihnachtstag und zu Silvester bewirtet haben: Die Essen
fanden etwa im Golfclub Lärchenhof und bei Luciano in der Kölner
Marzellenstraße statt.
Czaja hatte schon vor Monaten angekündigt, dass es sich bei einer
Fortführung des Rechtsstreits nicht vermeiden lasse, Dutzende von Zeugen
aus dem Kölner Wirtschaftsleben vorzuladen. Nun wollte er von ihnen
wissen, ob sie sich an diese Geschäftsessen erinnerten, wer
gegebenenfalls noch daran teilgenommen habe und ob es sich dabei nicht
um ein relativ ungewöhnliches Datum gehandelt habe.
Ein Getränkefachgroßhändler bestätigte dem Richter, er feiere
Weihnachten normalerweise mit der Familie. Ob er am ersten Weihnachtstag
2002 im Lärchenhof mit dem Brauerei-Mitinhaber gegessen habe, daran
könne er sich „beim besten Willen nicht erinnern“. Er könne sich aber
„vorstellen, dass es so gewesen ist“. Die Erinnerungslücken begründete
er damit, dass er sein Unternehmen Ende 2002 verkauft habe und sein
Terminkalender deshalb dicht gefüllt gewesen sei. Auch seiner Frau ging
es - so bezeugte sie vor Gericht - nicht anders. Czaja bekundete zwar
grundsätzlich Verständnis für Erinnerungslücken, zeigte sich aber
dennoch erstaunt, dass man einen so außerordentlichen Tag für ein
Geschäftsessen tatsächlich vergessen könne. Ähnlich war es beim
ehemaligen Geschäftsführer eines Kölner Verlags. Er verbrachte - so
führte er vor Gericht aus - das Weihnachtsfest mit seiner Frau
regelmäßig am Niederrhein, kehrte stets am 2. Weihnachtsfeiertag nach
Köln zurück und dann üblicherweise bei „Luciano“ ein. Es „könne sein“,
dass er dort Weihnachten 2002 auf Johannes Becker getroffen sei und dass
es dann zu einer „spontanen“ Bewirtung auf Kosten der Brauerei gekommen
sei. Ein bereits vorher vereinbartes Geschäftsessen für den 2.
Weihnachtstag halte er „nicht für sehr wahrscheinlich“, sagte der
Manager. Seine Frau sagte am Freitag aus, sie könne sich an das Essen
„nicht konkret erinnern“.
Deutlicher als die bis dahin erschienen Zeugen aus Köln äußerte sich ein
Getränkefachhändler aus Freiburg, der den eingereichten Belegen zufolge
insgesamt fünfmal auf Kosten der Brauerei bewirtet wurde. Dies treffe
für die angegebenen konkreten Termine nicht zu, sagte der Zeuge.
Eine weitere Getränkegroßhändlerin bestätigte, dass sie häufig („sicher
zweimal im Monat“) mit Heinrich Becker auf Kosten der Gaffel-Brauerei in
ganz unterschiedlichen Kölner Gaststätten gegessen habe. „Sehr
unangenehm“ sei aber gewesen, dass dessen Bruder Johannes ihr bei einem
Besuch in der Gaffel-Loge des Rheinenergie-Stadions bedeutet habe, sie
solle sich ihre Aussage vor Gericht „gut überlegen“. Er habe ihr damals
mitgeteilt, dass sie häufig als Gast in seinen eigenen Bewirtungsbelegen
aufgeführt sei und entsprechend aussagen möge. „Ich habe ihm damals aber
schon gesagt, dass wir nur ein einziges Mal zusammen gegessen haben und
dass ich dies auch so bezeugen werde“, teilte die Frau mit.
Die Beweisaufnahme wird im Mai fortgeführt. Als Zeugen geladen sind dann
weitere Prominente aus dem Kölner Geschäftsleben sowie Vertreter des
Kölner und des Deutschen Brauerei-Verbandes.
"Ein Tag voller Erinnerungslücken"
Artikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger von Willi Feldgen
"Kölsch ist dicker als Blut"
Artikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger von Willi Feldgen
Angesichts der beiden großen Anteilseigner der Brauerei, Heinrich und Johannes Becker, klingen diese wohlfeilen Werbesätze wie reiner Hohn. Die seit vielen Jahren verfeindeten Brüder meiden einander wie die Pest. Sie gehen sich aus dem Weg, wo es nur eben möglich ist. Anfang dieses Monats ging es nicht - da saßen sich die beiden, die im Jahr 50 Millionen Liter Gaffel-Kölsch verkaufen, vor Gericht gegenüber und ließen ihre Anwälte schweres Geschütz auffahren: getürkte Spesenabrechnungen, üble Nachrede und die gegenseitige Absetzung als Geschäftsführer sind Themen, die zu solchen Gelegenheiten in aller Öffentlichkeit verhandelt werden. „Trinken Sie Brüderschaft“ hat in diesem Umfeld kaum eine Chance.
Bier ist offenbar noch dicker als Blut. In der Kölner Brauerszene heißt es nämlich vor Gericht nicht nur „Becker gegen Becker“, sondern auch schon mal „Päffgen gegen Päffgen“. Rudolf Päffgen, der Brauereichef aus der Friesenstraße, hatte seinem Bruder Max vor Jahren untersagt, die Gaststätte am Heumarkt in der Kölner Altstadt weiterhin „Päffgen“ zu nennen. Der Hintergrund: In dem Lokal am Heumarkt war 30 Jahre lang Päffgen-Kölsch ausgeschenkt worden. Als Maxens Sohn Maximilian dann aber eine eigene Brauerei in Lohmar eröffnete, kündigte Max seinem Bruder den Liefervertrag und schenkte seitdem statt Päffgen das „Obergärige Pfaffen“-Bier seines Sohnes aus. Den eingeführten werbewirksamen Namen „Päffgen“ für das Haus am Heumarkt wollte Max allerdings behalten. Nachdem Rudolf dies gerichtlich untersagen ließ, bekundete Maxens Frau Ilka, das Päffgen-Kölsch ihres Schwagers schmecke „medizinisch“. Das kam bei Rudolf gar nicht gut an, und so gab es eine neue Verfahrensrunde vor Gericht und eine einstweilige Verfügung: Nach den Regeln des Wettbewerbsrechts wurde dieses subjektive „Geschmacksurteil“ als geschäftsschädigend eingestuft und die öffentliche Wiederholung untersagt.
Damit sind freilich noch längst nicht alle relevanten Hintergründe des Kölsch-Werbespruchs „Die Familie ist das Wichtigste im Leben“ abgehandelt. Ein langjähriger Alleinvorstand der Dom-Brauerei zum Beispiel hatte nach Erkenntnissen Kölner Gerichte die Familie mitunter höher geschätzt als seinen Arbeitgeber: Eine Sekretärin wurde für private Immobiliengeschäfte des Brau-Managers eingespannt, der Fahrer musste Brötchen holen, den Hund ausführen und den Vorgarten kehren. Zwei Dutzend „Dienstflüge“ des Chefs nach Mallorca dienten angeblich dem Aufbau des Dom-Kölsch-Vertriebs auf der Ferieninsel. Dort residierte der Alleinvorstand in der eigenen Finca, um - wie großherzig - die Brauerei nicht mit unnötigen Hotelkosten zu belasten. 4,2 Millionen Euro klagte die Brauerei schließlich von ihrem ehemaligen Chef als Schadenersatz ein. Nach jahrelangen Prozessen einigten sich die Parteien außergerichtlich - ohne Schuldanerkenntnis des ehemaligen Chefs. Die Dom-Brauerei erhielt einen Teil des eingeklagten Schadens ersetzt, darf ihre früheren Vorwürfe an die Adresse des pensionierten Chefs aber nicht wiederholen.
Auch bei Früh - Nummer drei der Kölsch-Marken hinter Reissdorf und Gaffel - hing in diesem Jahr der Haussegen schief: Der Miteigentümer der Früh-Brauerei, Rudolf Müller, war nicht gerade amüsiert, als in diesem Jahr eine neue Billig-Kölsch-Marke auf den Markt kam. Das „Traugott-Simon-Kölsch“ vom Getränkehändler trinkgut erinnerte in Aufmachung (rot / weiß) und grafischer Gestaltung unübersehbar an die fast doppelt so teure Früh-Kölsch-Flasche. Das war schon ärgerlich genug, schlug dem Fass aber noch nicht den Boden aus.
Pikanter war folgendes Detail: Zur Produktion ihres neuen Kölsch war trinkgut auf eine Brauerei in Köln angewiesen, denn Kölsch darf - bis auf ganz wenige festgelegte Ausnahmen - nur innerhalb der Kölner Stadtgrenzen gebraut werden. Fündig wurden die Handelsmanager bei der nicht ausgelasteten Sünner-Brauerei in Köln-Kalk. Die ging mit der Produktion des neuen Kölsch auf Konfrontationskurs zum großen Wettbewerber Früh. Dabei ist die Brauerei in Kalk ein ganz besonderer Wettbewerber von Früh: Ingrid Müller-Sünner ist nämlich die Gattin von Früh-Mitinhaber Rudolf Müller.
Was die Brauerei-Chefin dabei geritten hat, ist nicht bekannt. Möglicherweise ist es eine einfache kölsche Devise: Jeschäff es Jeschäff. Zu hören ist allerdings, dass Sünner nach diesem merkwürdigen Deal zumindest zeitweise aus den Regalen einiger Getränkehändler ausgelistet wurde. Im Fall Sünner gegen Früh kam es allerdings nicht zum Äußersten: Der Zwist des Kölner Brauer-Ehepaars wurde nicht vor Gericht, 50ndern innerhalb der Familie beigelegt.
"Schlammschlacht vor Gericht"
Artikel aus dem Kölner Stadt-Anzeiger von Willi Feldgen
30.08.2008
"Schlammschlacht um falsche Spesen"
Artikel aus globalmalt.de
Eine entsprechende Einigung ist aber nicht in Sicht - zumal Johannes Becker weiter gegen ein für ihn ungünstiges Urteil des Oberlandesgerichts ankämpft. Czaj sagte, er werde nun nicht umhinkommen, als Zeugen außer der Buchhaltung der Brauerei auch Prominente des Kölner Wirtschaftslebens und Mitarbeiter aus dem Golfclub in Naples / Florida, in dem Johannes Mitglied ist, vorzuladen. Johannes Becker war Anfang des Jahres von Heinrich Becker und dem Neffen Philipp Becker - sie halten zusammen 64 Prozent der Brauerei-Anteile - als geschäftsführender Gesellschafter abberufen worden. Zudem war Heinrich Beckers Sohn Heinrich Philipp (30) als Geschäftsführer der Brauerei eingesetzt worden. Gegen beide Beschlüsse hatte Johannes Becker geklagt und seinerseits die Abberufung seines Bruders gefordert. Heinrich Becker, so der Vorwurf, habe in großem Umfang private Ausgaben - zum Beispiel Tankrechnungen - über das Unternehmen abgerechnet und damit die Brauerei geschädigt. Ähnlich sei der Junior verfahren, der als Inhaber einer eigenen Gesellschaft („fresh nails GmbH“) Ausgaben für dieses Unternehmen - zum Beispiel Telefonkosten in fünfstelliger Höhe - zulasten der Brauerei abgerechnet habe. Die Beschuldigten erhoben daraufhin ihrerseits Gegenklagen mit ganz ähnlichen Vorwürfen: Danach rechnete Johannes über die Brauerei Spesen in Kölner Gaststätten und exakt zur gleichen Zeit Bewirtungskosten in New York ab. Rechtsanwalt Ralph Drouven sagte, Johannes verkrafte es offenbar nicht, als Geschäftsführer abberufen worden zu sein. Nun lege er es darauf an, die Familie seines Bruders in der Öffentlichkeit schlechtzureden, selbst wenn dadurch das Familienunternehmen „an die Wand gefahren“ werde. So habe er den Geschäftsführer eines großen deutschen Beratungsunternehmens ausdrücklich davor gewarnt, Heinrichs jüngeren Sohn einzustellen: „Sie wollen die Familie Ihres Bruders fertigmachen“, sagte Drouven. Gegen die Behauptung von Johannes, die Vermögensverhältnisse seines Bruders seien „zerrüttet“, sei am Freitagmorgen eine einstweilige Verfügung erwirkt worden: „Das behaupten Sie hier und heute zum letzten Mal“, sagte er an die Adresse von Johannes' Rechtsanwalt, Jürgen Sieger.
Verweis auf „Unmassen von Belegen“
Mit Verweis auf zwei Schränke mit Dutzenden von Aktenordnern und „Unmassen von Belegen“ hinter ihm sagte Czaja, das Gericht werde nicht die Abrechnung „von jedem Blumengruß nach New York, von Fotografen auf einer Geburtstagsfeier oder von der Reparatur einer Espresso-Maschine“ aufklären. Vielmehr werde er sich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren und unter anderem ermitteln, ob es möglich sei, dass „an zwei verschiedenen Punkten dieser Welt gleichzeitig Bewirtungskosten“ anfallen können. Umstritten sind zudem Ausgaben für Heinrichs Bier-Museum im Keller der Brauerei, private Fleischbestellungen beim Metzger, Ausgaben für ein Ferienhaus und für Deko-Material sowie das Sponsoring von Golfclubs.
Czaja deutete an, dass es - zumal angesichts nahezu spiegelbildlich gegeneinander erhobener Vorwürfe - „hohe Hürden“ vor einer Abberufung von Heinrich Becker als Geschäftsführer gebe. Eine entsprechende einseitige Entscheidung sei „kaum noch realistisch“. Denkbar sei allerdings, dass am Ende alle Gaffel-Geschäftsführer von ihrem Amt entbunden würden: „Dann werden dem Gesetz zufolge alle Gesellschafter auch wieder zu Geschäftsführern“, drohte Czaja den streitenden Parteien an. Angesichts des Risses, der durch die Familie gehe, sei es doch sinnvoller, eine Lösung zu finden, bei der alle Beteiligten „ihr Gesicht wahren könnten“. Gedacht ist dabei wohl unter anderem daran, dass einer der beiden Streithähne seine Anteile verkauft.
-----------------
Bei der Gaffel-Brauerei in Köln setzt sich im Streit um die
Geschäftsführung Heinrich Becker gegen seinen Bruder Johannes durch. Der
Gerichtsstreit zwischen den beiden Haupt-Gesellschaftern der
Gaffel-Brauerei, den Brüdern Heinrich (61) und Johannes Becker (57),
wird immer schmutziger. Vor Gericht haben sie sich gegenseitig
bezichtigt, bei den Spesen geschummelt zu haben. Damit holen sie sich
möglicherweise unangenehmen Besuch in ihre Geschäftsräume am Eigelstein.
Denn der 18. Zivilsenat führt in seiner am Donnerstag verkündeten
Entscheidung aus: „Es besteht durchaus ein Untreueverdacht“.
Besonders übel stieß dem Gericht auf, was Bruder Heinrich Becker
berichtete und belegte: Dass nämlich Johannes Becker (57)
Spesenrechnungen aus dem noblen „Restaurant Hase“ an der
St.-Apern-Straße im Unternehmen abrechnete, obwohl er zeitgleich in New
York weilte und dort Bewirtungsaufwendungen geltend machte.
Doch Johannes Becker schlug zurück: Auch sein Bruder Heinrich habe
private Ausgaben über den Betrieb abgerechnet: Mobilfunkrechnungen und
private Tankquittungen seiner Ehefrau und seiner Söhne.
Vor Richterin Brigitta Fox (63) fand die Schlammschlacht der beiden
Brüder am Donnerstag nur ein vorübergehendes Ende. Im Einstweiligen
Verfügungsverfahren auf Antrag von Heinrich Becker hat das Gericht
Johannes Becker verboten, in den nächsten sechs Monaten als
Geschäftsführer der Brauerei aufzutreten und zu handeln. Verstößt
Johannes Becker dagegen, muss er ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 €
zahlen.
Grund dafür war ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, wonach
Johannes ausgeschlossen werden sollte. Es gibt nur drei Gesellschafter:
Heinrich (hält 38 % an der Gaffel Brauerei Becker & Co. oHG), Johannes
(hält auch 38 %) und Neffe Philipp (24 %).
Und Heinrich hat mit Hilfe des Neffen Bruder Johannes einfach
überstimmt. In Justizkreisen rechnet man damit, dass Johannes Becker
jetzt in der Hauptsache Klage erhebt, um seine Ansprüche zu sichern.
Vorerst ist er aber seinen Geschäftsführerposten los.
"Bierfestung Köln steht offenbar vor dem Fall"
Artikel msn Nachrichten von Guido Hartmann
"Billig-Kölsch sorgt für Zoff "
Artikel im Kölner Express
Es gibt eine neue Kölsch-Marke. Mit seinem „Traugott Simon Kölsch“ hat sich Trinkgut Ärger mit Früh eingehandelt, weil das Etikett dem der Kölner Traditionsmarke zu sehr ähnelt.
Trinkgut hat sich den Ärger von Früh eingehandelt, weil das Etikett dem der Kölner Traditionsmarke zu sehr ähnelt. Vor wenigen Tagen hat sich deshalb Trinkgut in einer außergerichtlichen Unterlassungserklärung verpflichtet, dieses Etikett nicht mehr zu verwenden.
Am Mittwoch wurden in allen Trinkgut-Märkten die Etiketten überklebt. Auf den zukünftigen „Traugott-Simon-Chargen“ wird ein anderes Design zu sehen sein. „Diesen Entwurf haben uns die Herren von Trinkgut bereits vorgelegt, damit können wir leben“, so der neue Früh-Marketingchef Dirk Heisterkamp zu EXPRESS.
Für Verwunderung in der Szene sorgt allerdings, dass das Kölsch bei Sünner gebraut wird – weil Sünner-Inhaberin Ingrid Müller-Sünner die Ehefrau des Früh-Gesellschafters Hermann Müller ist. Gegen die Kölsch-Konvention verstößt Traugott Simon nicht: Es gibt eine Briefkastenfirma in Kalk, in Köln wird es auch gebraut. Sünner-Marketing-Chef Eberhard Fischer: „Ich verstehe die Aufregung nicht. Auch der Kölner Verbund vertreibt als Billigmarken Felskrone und Hansa Kölsch.“
Eisenbahn Kölsch aus Brasilien
"Aktionär rettet Dom-Brauerei"
Köln - Einen scharfen Absatzrückgang musste 2006 die Dom-Brauerei AG hinnehmen. Während es für alle Kölsch-Brauer im Schnitt nur einen Ausstoßrückgang um 1,3 Prozent gab, brach der Absatz von Dom um weitere 10,1 (Vorjahr minus 5,7) Prozent ein. Beim Flaschenbier betrug der Rückgang 8,4 Prozent, beim Fassbier sogar 11,0 Prozent, teilt das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht mit. Für diese Entwicklung macht das Unternehmen unter anderem die geringe werbliche Präsenz im Handel und den Verlust einiger Gastronomie-Großobjekte (darunter das Dom-Brauhaus auf dem verkauften Betriebsgelände) verantwortlich. Der Getränkeumsatz ging sogar um 12,0 Prozent auf 12,4 (14,1) Millionen Euro zurück. Auch in den ersten beiden Monaten 2007 gab es einen weiteren Absatzrückgang um 6,0 Prozent.
Trotz der miserablen Zahlen weist die Dom-Brauerei AG einen Jahresüberschuss von 2,0 (Vorjahr minus 730 000) Euro aus. Möglich war das aber nur, weil Christian Graf Dürckheim-Ketelhodt für die Vertriebsgesellschaft deutscher Brauereien mbH (VdB) als Mehrheitsaktionär der Dom-Brauerei auf Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 2,1 Millionen Euro verzichtet und (gegen einen Besserungsschein) Verbindlichkeiten gegenüber zwei Unterstützungskassen in Höhe von 2,2 Millionen Euro übernimmt.
Teuer ist für die Brauerei die Trennung vom ehemaligen Alleinvorstand Walter Baldus, der Ende Oktober 2006 „in bestem Einvernehmen“ - wie es im Geschäftsbericht heißt - aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Neben seinem Gehalt von 208 500 Euro für zehn Monate des Jahres 2006 erhielt er eine Tantieme von 80 000 Euro und zusätzlich 247 000 Euro für die Vertragsbeendigung. Neuer Alleinvorstand bei Dom ist seit einer Woche der bisherige Finanzchef Achim Zweifel, der vom Aufsichtsrat einen Vertrag bis Ende 2009 erhielt.
Obwohl sich die Liquiditätslage des Unternehmens (nach Grundstücksverkauf, dem Vergleich mit dem früheren Alleinvorstand Jochen Köhler sowie einer Kapitalherabsetzung mit anschließender Kapitalerhöhung) entspannt hat, bestehe weiterhin ein „Liquiditätsrisiko“ insbesondere durch die hohen Pensionszahlungen, heißt es im Geschäftsbericht. Jochen Köhler erhält seit Anfang 2007 wieder seine monatliche Pensionszahlung von 10 735 Euro, nachdem diese Zahlung während der gerichtlichen Auseinandersetzungen eingefroren worden war.
Die Geschäftsentwicklung der Dom-Brauerei wird auch vom Aufsichtsrat selbst als „schwierig“ eingestuft. Dennoch hält der Vorstand an seinen Plänen fest, eine neue Produktionsstätte aufzubauen. Seit Jahresanfang 2006 wird das Dom-Kölsch im Lohnauftrag von der Erzquell-Brauerei in Bielstein („Zunft-Kölsch“) produziert.
"Dom baut neue Brauerei"
Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger von Willi Feldgen
-- Vier Verfahren --
Zur Einberufung des Aktionärstreffen war das Unternehmen aus zwei Gründen gezwungen worden: Zum einen musste ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals angezeigt werden, zum anderen wurden die Aktionäre aufgefordert, dem vor Gericht geschlossenen Vergleich mit dem langjährigen Alleinvorstand Jochen Köhler zuzustimmen. Von ihm hatte das Unternehmen in insgesamt vier Verfahren einen Schadensersatz in Höhe von 4,2 Millionen Euro verlangt. Köhler erklärte sich in dem Vergleich bereit, 793 000 Euro in bar zu zahlen und auf Pensionsansprüche von rund 427 000 Euro bis Ende 2006 sowie eine früher zugesagte Karenzentschädigung von 767 000 Euro zu verzichten. Von Januar 2007 an erhält Köhler aber wieder seine volle Pension in Höhe von 10 735 Euro monatlich. Die Dom-Brauerei darf außerdem nicht mehr behaupten, der Ex-Vorstand habe seine Pflichten verletzt. Dürckheim und Zweifel betonten, die Zustimmung zu diesem Vergleich sei für beide Seiten „schmerzhaft“ gewesen. Man hätte aber anderenfalls mit weiteren mehrjährigen Auseinandersetzungen vor Gericht rechnen müssen. Zudem sei der Ausgang der Verfahren ungewiss gewesen. Zusätzlich zu den bereits angefallenen Anwalts- und Gerichtskosten in Höhe von 500 000 Euro hätten dann auch weitere Kosten von bis zu 800 000 Euro vorfinanziert werden müssen.
Der inzwischen 68 Jahre alte Köhler selbst sagte auf der Hauptversammlung, Ärzte und Freunde hätten ihm zum Abschluss dieses Vergleichs geraten. Sein von ihm selbst vorgeschlagener Nachfolger, der inzwischen wieder ausgeschiedene Walter Baldus, sei seinen Aufgaben nicht gewachsen gewesen und hätte „viel früher“ das Steuer wieder abgeben müssen.
Während einige Aktionäre den Vergleich ausdrücklich begrüßten, waren andere der Meinung, die Brauerei hätte den einmal eingeschlagenen Kurs weiterverfolgen und die Verfahren bis zu rechtskräftigen Urteilen durchziehen müssen. Eine breite Mehrheit der Aktionäre (die VDB allein hält rund 75 Prozent der Anteile) stimmte dem Vergleich schließlich trotzdem zu. Für Ende 2006 kündigte Zweifel einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von rund 3,5 Millionen Euro für die Dom-Brauerei AG an. Es gebe aber keinen Grund für einen Insolvenzantrag: Zum einen habe der durch Graf Dürckheim vertretene Großaktionär, die Vertriebsgesellschaft Deutscher Brauereien (VDB), einen Rangrücktritt für von ihr gewährte Darlehen in Höhe von 2,2 Millionen erklärt. Zum anderen reichten stille Reserven aus Markenrechten und Bierlieferverträgen aus, um den darüber hinausgehenden Fehlbetrag auszugleichen. Für 2007 erwarte man einen operativen Gewinn. Eine weitere Kapitalerhöhung sei für die erste Hälfte 2007 geplant.
"Glas Kölsch bis zu zehn Cent teurer"
Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger
Die Brauerei Früh hat ihre Preiserhöhung für den 27. November angekündigt. „Unsere letzte Erhöhung war im April 2004“, sagt Marketingleiter Dirk Heisterkamp und erklärt die Erhöhung mit gestiegenen Energiekosten. Der Endpreis sei „nicht endgültig geklärt“, so Heisterkamp, „der Stangenpreis wird vermutlich von 1,50 Euro auf 1,55 Euro steigen.“ Beim „Kölner Verbund“, der unter anderem die Marken Sion und Gilden Kölsch vertreibt, wurden die Preise für die Gastronomen um zehn Euro pro Hektoliter erhöht, sagt Verbundchef Wolf-Dieter Kölsch. Ein Kasten Gilden soll sich um 50 bis 60 Cent verteuern. Energie-, Transport- und Personalkosten seien deutlich gestiegen. „Die letzte Preiserhöhung ist vier Jahre her. Ich denke, das ist vertretbar“, sagt der Verbundchef.
Auch die Dom-Brauerei will die Preise um rund fünf Prozent anheben. Gaffel erhöht die Fassbier-Preise um gut fünf, die Flaschenbierpreise um drei Prozent, so Sprecher Michael Busemann. Kleinere Brauhäuser wie Päffgen und das Weißbräu wollen vorerst beim Stangenpreis von 1,30 Euro bleiben.
"Kölschbrauer hängen das Alt ab"
Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger
Köln - Die Bierspezialität Kölsch liegt inzwischen deutlich vor der Alt-Konkurrenz aus Düsseldorf und vom Niederrhein. Im ersten Quartal 2006 wurden nach den Zahlen des Brauereiverbandes NRW 567.000 Hektoliter Kölsch produziert. Das war ein Plus von 0,9 Prozent - "trotz eines miserablen März", wie der Kölner Verbands-Chef und Gaffel-Mitinhaber Heinrich Becker sagte. Alt kam nur noch auf 354.000 Hektoliter, das waren 12,8 Prozent weniger als vor einem Jahr.
Von der Fußball-WM mit den fünf Sielen in Köln erwarten die Kölsch-Brauer keinen nennenswerten Mehrabsatz. Weiter unklar ist, ob zur öffentlichen Übertragung auf Großbildschirmen Kölsch ausgeschenkt wird. Der "Kölner Verbund" (unter anderem mit Sion und Gilden) hat sich bei der Stadt beworben, aber nur mit einem deutlichen unter der geforderten "utopischen" Summe liegenden Betrag geboten, sagte der Verbund-Chef Wolf-Dieter Kölsch. Man habe aber bislang nichts von der Stadt gehört.
Der Kölner Brauerei-Verband hat im Internet eine Kölsch-Bier-Bibliothek eingerichtet (www.koelner-brauerei-verband.de/biblio). 120 Beiträge informieren ausführlich etwas über die Bier-Geschichte, das typisch kölsche Brauhaus und über einzelne Brauereien.
"Bierhähne im Dom-Brauhaus werden zugedreht"
Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger
Der neue Besitzer des Geländes will dort Einfamilienhäuser errichten
und Kleingewerbe ansiedeln.
Beliebter Biergarten wir geschlossen, Brauerei-Museum soll erhalten werden.
Karneval wird noch mal richtig auf den Putz gehauen. Anschließend locken Aktionstage und Abende mit kölschem Amüsemang" - bis am 31. März die Zapfhähne zugedreht werden und die Lichter ausgehen. Dann endet nach 25 Jahren die Geschichte eins der beliebtesten Brauhauser im Süden der Stadt -das Dom-Brauhaus an der Alteburger Straße macht zu. Auch das angeschlossene Brauereimuseum, in dessen Kellergewölbe die Besucher auf eine Zeitreise durch die Braugeschichte geschickt wurden und beim Blick auf 300 Reklame-Tafeln sehen konnten, wie einst für Gerstensaft geworben wurde, gehört ab 1. April der Vergangenheit an. Gleichzeitig sind die Tage des zum Brauhaus gehörenden Biergartens an der Schönhauser Straße gezählt, wo es sich im Sommer Tausende Gäste unter schattigen Kastanien, knirschenden Kies unter den Füßen, gut gehen ließen.
Den rund 20 fest angestellten Mitarbeitern ist zum 31. März gekündigt worden. Die Mehrzahl habe man in andere Betriebe vermitteln können, sagt der Pressesprecher der Dom-Brauerei, Michael Schürger. Die Firma werde versuchen, den übrigen Kollegen ebenfalls zu einem neuen Arbeitsplatz zu verhelfen. Mit dem Dom-Brauhaus, das vormals zur Küppers Brauerei gehörte, verlieren auch die Organisatoren der ,,Kölsche Weihnacht im Brauhaus" und des ,,Kölsch Milljö" ihre Spielstätte. Diese Veranstaltungen finden künftig im Eltzhof in Wahn statt.
Der Verkauf des rund 35.000 Quadratmeter großen Braugeländes im Sommer 2005 an eine Investorengruppe war Teil des Sicherungskonzepts der Dom-Brauerei AG, die kurz vor der Insolvenz stand. Mit dem Erlös hat die Brauerei Bankverbindlichkeiten getilgt. Seit Beginn dieses Jahres lasst das Traditionsunternehmen, dessen Konsolidierung inzwischen abgeschlossen ist, seine drei Marken Dom, Giesler und Rats Kölsch nach eigener Rezeptur im Lohnbrauverfahren bei der Erzquell Brauerei in Wiehl-Bielstein herstellen.
Die Entscheidung, sich von dem Brauhaus zu trennen, sei dem Unternehmen nicht leicht gefallen, beteuert Sprecher Schürger. Das gediegene Mobiliar des Brauhauses soll in andere Gaststatten integriert wer¬den, ,,immerhin beliefern wir 2500 Betriebe" (Schürger). Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es in Köln mittelfristig ein neues Dom-Brauhaus geben wird. Nur wann und wo, sagt Schürger nicht, dazu sei es noch zu früh. Die Museums-Exponate werden zwischengelagert. ,,Sie sollen den Kölnern nicht verloren gehen", verspricht Schürger. Das gleiche gelte für die Sudkessel aus dem Biergarten, ,,verschrottet wird nichts".
Das Dom-Brauhaus werde definitiv abgebrochen, weil dies im Vertrag mit der Brauerei so festgelegt sei, sagte Hermann J. Kempis, Gesellschafter der Kölner Dom-Garten (KDG), die das gesamte Brauereigelände erworben hat. Er konne sich neben den dort geplanten Einfamilienhausern, Eigentumswohnungen und ,,dezenten Kleingewerbebetrieben" gut einen schönen Gastronomiebetrieb vorstellen, in den etwa auch das bisherige Brauerei-Museum integriert werden könne. Allerdings müsse dafür ein geeigneter Betreiber gefunden werden, sagte Kempis. Für einen Biergarten - zumal in der derzeitigen Größenordnung - sehe er bei der geplanten Bebauung aber nur wenig Chancen.
"Lesen Sie Schlök doch einmal rückwarts"
Die Nassauischen Privatbrauerei in Hahnstätten macht dies so. Ihr helles obergäriges (nach kölscher Brauart) gebrautes Bier heißt ganz einfach "Schlök". Ob das der Kölner Brauereiverband noch nicht gemerkt hat?
Passender Weise ist auf den Schlök-Gläsern (natürlich Kölschstangen) der Kölner Dom abgebildet (anzuschauen im Bereich "Weitere Informationen" -> "Pseudo-Kölsch").
"Dom-Kölsch wird bei Erzquell gebraut"
Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger
"Kölsch erobert Düsseldorf"
Artikel im Kölner Express
Kölsch erobert Düsseldorf / Brauerei Gaffel stößt über den „Bieräquator” vor.
Köln/Düsseldorf – Es ist eine Bier-Revolution: Im absoluten Feindesland wird ein Kölsch-Brauhaus eröffnet – in Düsseldorf!
Ab dem 9. Juni wird im Szene-Viertel Medienhafen frisch gezapftes Gaffel-Kölsch ausgeschenkt. Schon der Name lässt keine Zweifel daran, dass es sich um ein urkölsches Refugium handelt: Die Kneipe wird „Eigelstein“ heißen.
„Das hat einen schönen Klang und liest sich gut“, meint Geschäftsführer Malte Wienbreyer, der mit seinen Kollegen Jörn Klingenheben und Jürgen Köster die Kneipe betreibt, zum Titel. Er glaubt an einen Erfolg, setzt auf das tolerante Wesen des Altbiertrinkers: „Es wäre wohl problematischer, Alt in Köln auszuschenken.“
Kölsch in Düsseldorf: Am Medienhafen soll das Konzept funktionieren. „Wir denken, dass der Ort richtig ist. Hier kommen viele Menschen aus dem Umland hin“, sagt Wienbreyer. Und die trinken vermehrt Kölsch: „Seit 2003 wird bundesweit ja erstmals mehr Kölsch als Alt verkauft.“
400 Plätze hat das Brauhaus hinter den feindlichen Linien. Zum leckeren Bier wird es traditionelle Kölner Küche geben – zubereitet von zwei waschechten Düsseldorfer Köchen. Der fröhliche Zecher muss für seinen Genuss allerdings einen stolzen Preis zahlen: 1,45 Euro kostet in der Landeshauptstadt die 0,2er-Stange.
Für die Gaffel-Brauerei war der Vorstoß über den „Bieräquator“ nur folgerichtig. Geschäftsführer Wilfried Schwab: „Wir wollen da sein, wo uns unser Klientel erwartet.“ Unglaublich, aber wahr: „Viele Kölner fahren am Wochenende zum Feiern und Trinken nach Düsseldorf“, so Schwab. Was ihnen sicher fehlte, kommt nun nach – das Kölsch.Rund 700.000 Euro haben die Geschäftsführer ins Düsseldorfer „Eigelstein“ investiert. Für sie ist es denkbar, noch weitere Kölsch-Gaststätten in Düsseldorf zu eröffnen. Wienbreyer: „Wir denken da aber in kleinen Schritten. Aber in der Altstadt werden wir nix machen. Das wäre dann wohl doch zuviel…“
"Dom verkauft das Brauereigelände"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Willi Feldgen
Mit dem Erlös aus dem Grundstücksverkauf sollen die Schulden der Dom-Brauerei deutlich sinken.
Köln - Das Dom-Kölsch wird künftig nicht mehr in der eigenen Braustätte des Unternehmens hergestellt. Die Dom-Brauerei AG hat ihr gesamtes Betriebsgelände an der Alteburger Straße in Köln-Bayenthal, das sie erst 2001 von Küppers übernommen hatte, wieder verkauft. Ein entsprechender Vertrag sei mit einem Immobilien-Investor unterzeichnet worden, teilte die Dom-Brauerei AG mit. Der Aufsichtsrat muss noch zustimmen. Mit dem Geld aus dem Verkauf des Geländes will die Brauerei ihre Schulden deutlich abbauen, heißt es. Ob der beliebte Biergarten und die Gaststätte erhalten bleiben, ist ungewiss.
Lohnbrauverfahren
Die Brauerei teilt mit, dass der Verkauf ihres einzigen Betriebsgrundstücks eng verknüpft sei mit der „strategischen Konzeption, das Bier künftig im Wege des Lohnbrauverfahrens herzustellen.“ Übersetzt heißt dies, dass die Dom-Brauerei ihr Kölsch künftig von einem Wettbewerber herstellen lässt und - ohne eigenes unternehmerisches Herz - selber nur noch den Vertrieb übernimmt.
Nahe läge zum Beispiel, dass der „Kölner Verbund“ künftig das Dom produziert. Die zu Oetker (bis Anfang 2004 zu „Brau und Brunnen“) gehörende Gruppe stellt in ihrer Kölner Braustätte, der Bergischen Löwenbrauerei Mülheim, ihre sechs Kölschmarken Sion, Gilden, Maximilian, Sester, Peters und Küppers sowie im Lohnbrauverfahren auch Ganser und Römer Kölsch her. Hier wird außerdem bereits das Dom-Kölsch in Flaschen abgefüllt, weil Dom selbst nicht über eine entsprechende Anlage verfügt. Man habe hier aber nicht die notwendigen freien Kapazitäten, um das Dom auch noch selbst zu brauen, heißt es bei Oetker. Als weitere Möglichkeit gilt in der Branche, dass sich zwei Kölsch-Brauer mit freien Kapazitäten die Dom-Produktion teilen. So könnte etwa das Flaschen-Bier bei der Erzquell Brauerei in Bielstein (Zunft-Kölsch) produziert werden, während das Fassbier aus der zu Gaffel gehörenden Richmodis-Brauerei in Köln-Porz kommt. Eine Bestätigung dafür gab es am Montag aber nicht. Dom-Chef Walter Baldus äußert sich erst nächste Woche, weil er mit OB Schramma und Messe-Chef Witt in Japan weilt.
Im Suff ans Steuer, Früh sagt(e) ja
Zitate von einem alten Bierdeckel
Die Zeiten ändern sich. Auf einem Früh-Bierdeckel (vermutlich aus den frühen siebziger Jahren) ist folgendes wortwörtlich abgedruckt:
“Wie steht es um die Promille? Auch Autofahrer brauchen auf ihr Bier nicht zu verzichten. Es enthält nämlich nur etwa 4% Alkohol. Wer vier Glas trinkt (je 1/4l), bleibt mit ca. 0,4 Promille* weit unter der Grenze für die absolute Fahruntüchtigkeit. * Gemächliches Trinken, Gesundheit und normales Körpergewicht vorausgesetzt“.
"Das grenzt ja an Blasphemie"
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Thomas Morchner
Seit zwei Wochen fließt in Peter Essers „Braustelle“ in der Christianstraße selbst gebrautes Altbier. Peter Esser (36) hat wirklich Mut. Er ist Braumeister, betreibt in Ehrenfeld die „Braustelle“ und braut in seinen Kesseln - Altbier. Und das direkt vor den Augen seiner Gäste. Die Brauanlage ist, nach Essers Angaben, Kölns kleinste Brauerei und nur durch ein dünnes Band vom Schankraum getrennt. „Ehrenfelder Alt“ nennt Esser seine neuste Kreation, die er neben seinem selbst gebrauten Helios-Kölsch und Weizen ganz selbstverständlich an seine durstigen Gäste ausschenkt. „Ich bin gebürtiger Düsseldorfer, lebe aber seit zehn Jahren in Köln. Weil ich kaum Zeit habe, in meine Heimatstadt zu fahren, um da Alt zu trinken, habe ich entschieden, es einfach selber zu machen“, sagt der Diplom-Braumeister. Seit dem 5. November fließt aus seinen Zapfhähnen das dunkle, herbe Altbier. „Ein bisschen mulmig war mir bei der Einführung schon zumute“, gesteht Esser, „doch dann habe ich mir gedacht: Wenn es niemand haben will, trink ich es halt alleine.“ An den ersten Tagen war die Sache mit dem Altbier vor allem für seine Stammgäste ein echter Schlag ins Gesicht. „Ich musste mir einiges anhören“, erzählt Esser, „von Sprüchen wie: »Wir sind dir wohl nicht katholisch genug!« über »Jetzt müssen wir auch noch Feindes-Bier trinken«, bis hin zu »Das grenzt ja an Blasphemie« war alles dabei.“ Doch die Aufregung der Kölsch-Gemeinde legte sich oft nach dem ersten Schluck vom Ehrenfelder Alt. Die 300 Liter, die Esser vor zwei Wochen gebraut hat, sind jedenfalls schon fast weg. Zwei Euro kostet das 0,3 Liter Glas Alt, 3,30 Euro der halbe Liter. Ist die Alt-Einführung in seiner Wirtschaft letztlich gut über die Bühne gegangen, steht der eigentliche Härtetest für den 36-Jährigen noch aus. In der kommenden Woche findet der regelmäßige Stammtisch aller Kölner Braumeister statt. „Ich bin schon jetzt gespannt, was die Kollegen zu meiner Idee sagen werden“, sagt Esser. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kölsch-Braumeister bei den Rezepten des Düsseldorfers kräftig schlucken müssen. Esser sagt: „Ich habe fast jeden Monat ein Spezialbier im Angebot. Ein Sommerweizen, das mit Koriander gewürzt ist zum Beispiel. Da müssen die Traditionalisten schon hart im Nehmen sein“, sagt der Brauer. Seit fast drei Jahren gibt es die urige Eckkneipe in der Christianstraße. Wieder in einen „normalen“ Brauereibetrieb zurückzukehren kommt für Peter Esser nicht mehr in Frage. „Da ist alles so automatisiert. Das wär nichts mehr für mich.“
In Köln braut sich was zusammen.
Artikel im Kölner Stadtanzeiger von Willi Feldgen
Gewinner im Kölsch-Konzert sind nur die drei großen Privatbrauereien
Nach einem überraschenden Absatzplus im Jahr 2003 ist der Ausstoß der Kölsch-Brauereien in diesem Jahr wieder rückläufig. Damit setzt sich der seit 20 Jahren anhaltende Abwärtstrend fort. Nach der Statistik des Kölner Brauerei-Verbands ging die Produktion im ersten Halbjahr 2004 um gut zwei Prozent auf 1,25 Millionen Hektoliter zurück. Doch bei weitem nicht alle Brauer in Köln sind unglücklich über ihre Zahlen, denn zwischen den Marken gibt es große Unterschiede. Gewinner im Kölsch-Konzert sind vor allem die drei großen Privatbrauereien Reissdorf (etwa 600 000 Hektoliter im Jahr), Gaffel (470 000) und Früh (440 000 Hektoliter). Obwohl diese drei im Handel für ihr Flaschenbier die höchsten Preise verlangen, gewinnen sie immer größere Marktanteile hinzu. Branchenkenner loben die konsequente Marken- und Preispolitik.
Zusammen kommen die drei „Premium-Marken“ auf 60 Prozent des Kölsch-Absatzes. Zu den Verlierern gehört dagegen die Dom-Brauerei mit einem Ausstoß, der von 300 000 auf inzwischen deutlich unter 200 000 Hektoliter gesunken ist. Der starke Rückgang wird vor allem dem früheren Dom-Management angelastet. Während Früh, Gaffel und Reissdorf in Familienbesitz sind, handelt es sich bei Dom um eine Aktiengesellschaft, deren Aufsichtsratschef Christian Graf Dürckheim-Ketelhodt weit weg von Köln sitzt - nämlich in London.
Angestellte Manager gehen mit einem Unternehmen offenbar wesentlich leichtfertiger um als private Eigentümer, die auf das Geld ihrer eigenen Familie achten müssen. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass dem früheren Dom-Chef Jochen Köhler auf der Hauptversammlung in der nächsten Woche die Entlastung verweigert werden soll. Er habe sich - so der Vorwurf - zu wenig um das Kerngeschäft bemüht und stattdessen Immobiliengeschäfte getätigt, die das Unternehmen in rote Zahlen trieben.
Problematisch ist auch die Entwicklung bei den Kölsch-Marken der Brau und Brunnen AG. Mit Sion, Gilden, Küppers, Kurfürsten, Sester und Peters verfügt der Dortmunder Brau-Konzern über einen wahren Gemischtwarenladen, kam damit aber noch Ende der 90er Jahre auf einen stolzen Anteil von 30 Prozent im Kölsch-Markt. Dann verlor Küppers jedoch immer schneller Marktanteile und 2001 verkündete der damalige Konzernchef Michael Hollmann die Entscheidung, das Marketing für die renditeschwache Marke Küppers einzustellen. Um den verbliebenen Marken ein deutlicheres Gesicht zu geben, wurde der Vertriebs- und Marketingchef von Gaffel, Udo Hopf, abgeworben. Er trieb die Umstrukturierung und Sanierung des „Kölner Verbunds“, wie die Kölsch-Marken von Brau und Brunnen heißen, voran.
Dabei halfen klare Positionierungen der einzelnen Marken: Sion ist die relativ teure Edel-Marke mit hohem Fassbieranteil in der Gastronomie, darunter sind Gilden als mittelpreisige Konsummarke und Kurfürsten als Marke für Bonn angesiedelt. Sester besetzt das Preiseinstiegs-Segment. Küppers als im Handel am weitesten verbreitete Marke bleibt im Portfolio. Das Unternehmen schaffte die Wende, steigerte den Absatz 2003 deutlich und lieferte ein respektables siebenstelliges Ergebnis an die Mutter in Dortmund ab. Doch schon 2004 verzeichnen ausgerechnet diese Kölsch-Marken kräftige Einbußen. Ein Grund dafür ist womöglich eine verfehlte Unternehmenspolitik: Hollmann hat 2003 die regionalen Führungen der West-Geschäfte (also Jever im Norden, Brinkhoffs in Dortmund, Schlösser in Düsseldorf und die Kölsch-Marken in Köln) aufgelöst und in der Dortmunder Zentrale zusammengefasst.
Ein womöglich folgenschwerer Fehler: Die Bierverleger, traditionell entscheidende Vermittler zwischen den Brauereien und den Absatzstätten, empfinden sich längst nicht mehr nur als Logistik-Dienstleister, sondern gestalten den Markt mit. Dabei bevorzugen sie Ansprechpartner in ihrem direkten Umfeld. Die Zentralisierungstendenz von Brau und Brunnen geht sogar so weit, dass es den Kölner Verbund als selbstständige Tochter schon gar nicht mehr gibt und dass auch im Geschäftsbericht nicht mehr - wie bisher üblich - die Absatzzahlen der eigenen Kölsch-Marken genannt werden. Inzwischen verlieren die Kölsch-Marken des Konzerns dramatisch an Absatz. Mit dem im Februar vollzogenen Verkauf von Brau und Brunnen an die Oetker-Gruppe - zu ihr gehören Radeberger und Binding - könnte sich das Problem der betroffenen Kölsch-Marken noch verschärfen. Setzt sich nämlich die Entwicklung des ersten Halbjahres fort, verlieren die Kölner Marken dieses Jahr 60 000 Hektoliter.
Nach einer Faustformel würde das eine Belastung des Ergebnisses von 1,5 Millionen Euro bedeuten. Der deutliche Rückgang bei Dom und den Kölsch-Marken von Brau und Brunnen kommt den Wettbewerbern gelegen. „Wir wachsen durch höhere Absätze in den Regionen außerhalb Kölns und können uns außerdem auch die Schwäche von Konkurrenten wie Dom oder dem Kölner Verbund zunutze machen“, sagt Gaffel-Marketingchef Georg Schäfer. Bislang hat sich Oetker nicht entschieden, was der Konzern mit den Kölsch-Marken anfangen will.
Ohne entschlossenes Gegensteuern droht den Marken ein ähnliches Schicksal wie der Dom AG. Eine Rückverlagerung der Verantwortung nach Köln wäre eine Möglichkeit. Denkbar ist auch, das Kölsch abzugeben. Möglicher Käufer könnte die Bitburger Brauerei sein.
Peters braut für Brau und Brunnen.
Artikel im Kölner Stadtanzeiger
Novum im Biermarkt: Kölsch überholt Alt.
Artikel im Kölner Stadtanzeiger (Quelle: dpa)
Bislang wurde mehr Alt als Kölsch produziert. Das am Niederrhein beheimatete Alt kam nach Einschätzung von Branchenkenner in diesem Jahr durch das Dosenpfand etwas aus dem Tritt. Der Anteil der Dosen- Abfüllung sei höher als bei Kölsch, das fast nur in Fässer sowie Mehrwegflaschen fließe. Von der Rekordhitze profitierten Biergärten, in denen viel Fassbier an die durstigen Gäste ausgeschenkt wurde.
"Nach wie vor liefern sich beide Sorten ein Kopf-an-Kopf-Rennen", sagte Verbandsgeschäftsführer Jürgen Witt am Donnerstag auf Anfrage. Im Zeitraum Januar bis Ende September 2003 seien die Unterschiede mit 1,93 Millionen Hektolitern Alt und 1,96 Millionen Hektolitern Kölsch minimal. "Das sind Spezialitäten, die bleiben werden", betonte er.
"Wenn die Dosenpfand-Problematik nicht gewesen wäre, hätten wir nach langer Zeit wieder ein Plus ausgewiesen", schilderte Witt mit Blick auf den heißen Sommer. So liege nun aber der Gesamtausstoß der Brauereien Nordrhein-Westfalens in den ersten neun Monaten 2003 mit 19,7 Millionen Hektolitern um 7,9 Prozent niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Es sei zu befürchten, dass im Gesamtjahr 2003 die Bierproduktion im Bundesland um mindestens 5 Prozent zurückgehe.
Die unterschiedlichen Marktbewegungen von Kölsch und Alt lassen sich auch im Lebensmittel-Einzelhandel ablesen. In den Monaten August und September 2003 habe Kölsch einen bundesweiten Marktanteil von 2,4 Prozent belegt, verlautete in Branchenkreisen. Das entspreche einer Verbesserung um 0,3 Prozentpunkte. Das Altbier habe sich dagegen um 0,2 Prozentpunkte auf 1,9 Prozent verschlechtert. Darin sind jedoch nicht Biermischgetränke enthalten, bei denen das Altbier stark ist. (dpa)
Yes! New York trinkt Kölsch
Artikel von Daniel Cremer im Kölner Express
Die Kneipe „Loreley“ wurde mit vielen Litern Obergärigem und der Ehrengarde eröffnet. Dazu: Zig witziges rund ums Bier
New York – Kölsche Tön, 500 Liter Gaffel-Kölsch, klasse Stimmung: Am Samstag wurde in der New Yorker Rivington Street die Kölsch-Kneipe „Loreley“ eröffnet.
Die ersten Gäste kamen vom Rhein: Helmut Meindorf, Präsident des Senats der Ehrengarde, zog mit 44 Mann in die Kneipe ein. Klar, dass er für Chef Michael Momm Orden und Ehrenurkunde mit über den großen Teich gebracht hatte. Die Grün-Gelben – sie sind gerade auf Senatstour in der Metropole.
Karneval und kölsche Tön – in der „Loreley“ war gleich gute Stimmung. So feierte auch das New Yorker Dreigestirn Peter Holler (Prinz), Perry Kummer (Jungfrau) und Paul Himmelheber (Bauer) mit. Die drei, die in New York jedes Jahr das Dreigestirn bilden, gehören zu den „Kölschen Funken New York von 1961“ – einem Bruderverein der Roten Funken.
Zur Musik von Bläck Fööss, Höhnern und anderen feierten 200 Gäste bis spät in die Nacht – New Yorker Polizisten inklusive. Die kamen um 23 Uhr: Nachbarn hatten sich über die Lautstärke auf der Terrasse beschwert. Sie wurde prompt geschlossen. In NY geht’s halt genauso zu wie bei uns in Kölle...
"Gerstensaft vom Bischoff nebenan", Artikel von Alexandra Ringendahl im Kölner Stadtanzeiger
Brühl - Ein Jahr ist es jetzt her, dass das letzte Giesler-Kölsch aus den Zapfhähnen der Brühler Kneipen floss. Schon damals probte der Wirt der Margareten-Klause den Aufstand: Bis das allerletzte Fass zur Neige ging, schenkte Tasso Simeonidis Giesler-Kölsch aus. „Aus Überzeugung - weil es besser schmeckt und die Leute ein regionales Bier trinken wollen“, wie er damals sagte.
Und nun, am Tag des Bieres gestern, feiert er seinen persönlichen Sieg wie David seinerzeit nach dem Kampf mit Goliath: Nach einer erfolgreichen Klage gegen die Dom-Brauerei steht für ihn fest: In seiner Kneipe fließt auch weiterhin regionales Bier. Nämlich Bischoff-Kölsch - aus der kleinsten der zwölf Kölsch-Brauereien Deutschlands und neben der Hüchelner Urstoff-Brauerei der einzigen im Erftkreis. Damit ist die Margareten-Klause die einzige Kneipe im Erftkreis, die das Bier des kleinen Familienbetriebes, der genau zwischen Brühl und Hürth liegt, ausschenkt. Aber da auf den Fässern „Bischoff-Brauerei - Brühl-Vochem“ steht, ist es halt echtes Brühler Bier.
Der Druck von Seiten der Dom-Brauerei sei immens gewesen, erzählt Simeonidis. Aber er weigerte sich standhaft dagegen, dass der Vertrag, den er mit der Giesler-Brauerei hatte, nun automatisch auch für die Dom-Brauerei gelten sollte. „Ich hatte schließlich einen Vertrag mit Giesler und eben keinen mit Dom.“ Die Dom-Brauerei sah das natürlich anders. Sie pochte darauf, dass der Vertrag nun auf sie übergehe. Parallel dazu lockte Dom mit finanziellen Ködern: Wirten, die die Übernahme des Vertrages ohne Widerspruch akzeptierten, wurden Belohnungen versprochen. Im Fall des Wirtes Simeonidis gut 63 000 Euro. „Das ist der Grund, warum es für kleine Brauereien so schwierig ist, ihr Kölsch auch in Kneipen in den Ausschank zu kommen“, erklärt Wilhelm Bischoff. Gegen die Vertragspolitik der großen finanzstarken Brauerein sei schwerlich anzukommen.
„Aber gerade die finanziellen Köder sind oft Blenderei. Mittelfristig holt Dom das durch die lang laufenden Verträge über einen steigenden Bierpreis wieder rein“, analysiert Simeonidis. Für ihn ist der juristische Sieg gegen den Brauereiriesen jedenfalls eine Genugtuung. „Und die Treue zum regionalen Bier, die hat sich gelohnt. Ich habe meine Umsätze trotz allgemeiner Klagen in der Gastronomie verdoppelt.
"Erstes Nicht-Kölsch aus Köln, Gaffel braut neues Bier "1396" ,www.city-guide.de
Das helle, obergärige Bier mit sechs Prozent Alkohol-Gehalt komme an diesem Donnerstag (14. November) auf den Markt, teilte ein Sprecher der Privatbrauerei am Mittwoch in der Domstadt mit.
"1396" richte sich vor allem an junge Bierfreunde und wolle sich als Szene-Getränk etablieren. Gaffel sei damit die einzige Kölner Brauerei, die bundesweit ein Nicht-Kölsch anbiete, sagte der Sprecher.
Hinter dem ungewöhnlichen Namen "1396" verberge sich eine Rechenformel. "Eins mal Drei plus Neun minus Sechs ergibt eine Sechs, also den Alkohol-Gehalt des neuen Biers", erklärte der Gaffel- Sprecher.
Als Nummer Sieben unter den deutschen Fassbierbrauereien habe das Unternehmen bei seiner Marke Gaffel-Kölsch im vergangenen Jahr den Absatz auf rund 500 000 Hektoliter gesteigert.
Wie das Kölsch werde das neue "1396" zu den hochpreisigen Bieren gehören. Eine Absatz- Prognose wollte das Unternehmen nicht geben. "Der Konsument entscheidet, ob das Bier ankommt und die Marke wirkt oder nicht." (www.gaffel1396.de).
"Der Kölschstange geht es an den Kragen", Artikel von Ralf Johnen im Kölner Stadtanzeiger
Als Zeuge einer „wundersamen Biervermehrung“ wähnte sich der Bonner Gastronom Toni Mürtz („Im Sudhaus“), als er vor einigen Monaten ein paar vorbildlich gezapfte, später jedoch abgestandene Kölsch
betrachtete. Grund: Der Schaum war zusammengesackt und der Pegel stand deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenem Füllstrich. Bestrebt, in Zeiten angespannter Wirtschaftslage unnötige Verluste zu vermeiden, wandte sich der Wirt - ideell unterstützt von allen Kölner Kollegen - an Udo Hopf, Geschäftsführer des Kölner Verbund Brauereien. Dieser entschloss sich, den Missstand einer „objektiven Situationsbetrachtung“ zu unterziehen. Als kompetente Instanz wurde die Berliner Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei (VLB) auserkoren. Gestern nun wurden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung vorgelegt.
„Schaum ist auch Bier“, eröffnete Heinz Michael Anger, Abteilungsleiter des Zentral-Laboratoriums beim VLB, seine Ausführungen, die als Todesurteil für die Kölschstange der Gegenwart gelten dürfen. Immer länger und schmaler waren die schlichten Zylinder in den vergangenen 20 Jahren geworden, aus ästhetischen Gründen, wie es heißt. Dass sich dabei im Laufe der Zeit die Glasoberkante immer weiter vom Füllstrich entfernte, schien lange keine Rolle zu spielen. Hatte der Abstand einst bei der vorgegebenen Mindestmarke von zwei Zentimetern gelegen, so werden derzeit bis zu 40 Millimeter mit Schaum gefüllt. Mit der Folge, so Anger, dass sich in einem meisterlich gezapften Kölschglas zwischen 13 und 18 Milliliter mehr befindet, als die in Rechnung gestellten 0,2 Liter.
Weiteres Laborergebnis: Die Füllstriche beziehen sich auf jene maximale Dichte, die Flüssigkeiten bei einer Temperatur von 20 Grad erreichen. Weil Kölsch aber in der Regel bei acht Grad serviert wird, ist es dichter und die ausgeschenkte Menge größer. Rechnet man den eigentlichen Schankverlust hinzu, kommt Gastronom Mürtz auf einen Schaden in der Größenordnung von zehn bis elf Prozent.
Nun möchten die Auslöser der Revolte nicht als Kniesköppe in die Geschichte eingehen, in Maßen gönnen sie dem Kunden den Bierbonus sogar. Viel mehr haben die Rebellen die Abrechnung mit dem Finanzamt im Visier. Dieses akzeptiert lediglich einen Schankverlust in Höhe von drei Prozent, Kölner Wirte, weiß Verbundbrauer Hopf, dürfen zuweilen auch fünf Prozent abschreiben. Ergo: „Hier sind Nachbesserungen nötig.“ Den schwarzen Peter bekommen nun die Gläserhersteller zugeschoben, schon bald werden diese zwischen fünf und zehn Millimeter kürzere Stangen ausliefern.
Dem Finanzminister droht nun nicht nur aus dem Rheinland Ungemach: Der Kölner Auftrag hat das Interesse von Laborleiter Anger geweckt, der aus Eigeninitiative auch Pilsgläser getestet hat. Ergebnis: Diese sind auf Grund ihrer voluminösen Öffnung und der hohen Schaumkrone noch weitaus gierigere „Ressourcenverschwender“.
"Geheimplan: Sion soll Kurfürsten ersetzen", Artikel von Detlev Schmidt im Express
Sie wollen das Kurfürsten weiterlebt? Äußern Sie sich auf der folgenden (externen) Website: http://mitglied.lycos.de/ kurkoelschforever/
Kölner Verbund verhandelt mit Bonner Wirten
Der Chef kam höchstpersönlich aus Köln angereist: Udo Hopf, Geschäftsführer des Kölner Verbundes und damit auch Boss von Kurfürsten machte in geheimer Mission die Runde bei der Bonner Wirteprominenz.
Dabei ging es einmal um die Kölsch-Stangen-Affäre, aber auch um ein noch viel brisanteres Thema: Langfristig soll die in Bonn zu 80 Prozent den Markt beherrschende Marke Kurfürsten eingestellt werden. Und da der Kölner Verbund natürlich den Bonner Markt nicht kampflos aufgeben will, bot Hopf den Wirten als Ersatz Sion-Kölsch an. In den nächsten drei Jahren sollen die Bonner Kneipen auf das – zugegebenermaßen sehr leckere – Sion umgestellt werden.
Ein logistischer Millionenaufwand, der sich auf lange Sicht trotzdem rechnet, denn die Kölner wollen unter dem Druck der Konzernspitze in Dortmund ihre Kölschmarken reduzieren. Sion linksrheinisch, Gilden rechtsrheinisch als starke Fassmarken und Küppers für die Dose. Auf der Strecke bleiben Sester, Kurfürsten und Maximilian.
Sudhaus-Chef Toni Mürtz, im Hotel- und Gaststättenverband Sprecher der Bonner Wirte, kann sich mit den Plänen von Udo Hopf durchaus anfreunden. Und auch etliche andere Bonner Wirte signalisierten dem Brauer-Chef, dass sie zu einem Wechsel von Kurfürsten zu Sion durchaus bereit sind. Mürtz: „Der Vorschlag von Herrn Hopf ist bei mir und vielen Kollegen auf Zustimmung gestoßen.
Tatsächlich erfreut sich das Kölner Traditions-Kölsch Sion mit dem hochwertigen Brauhaus am Alter Markt nicht nur bei den Kölnern größter Beliebtheit. Rheinbrücken-Chef Rüdiger Klein: „Das Glas und die Werbung sind absolut edel.
Hopf hatte bereits vor Wochen für Aufsehen in Bonn gesorgt, als er den Gastroführer des Bonner EXPRESS nicht von Kurfürsten, sondern von Sion präsentieren ließ. Ein eindeutiger Hinweis auf die neue Ausrichtung des Kölner Verbundes. Und einen ersten Abschluss kann er auch schon vermelden: Großgastronom Jürgen Harder (Brückenforum) wechselt schon Silvester von Kurfürsten zu Sion.
Übrigens: Auch in Sachen Kölsch-Stangen kündigte Hopf bei seinem Besuch in Bonn eine Offensive seiner Brauerei an. So soll bei einer Pressekonferenz am kommenden Dienstag im Sudhaus eine Lösung des Problems angeboten werden: neue Gläser.
"Ein Kölsch für alle Fälle", Artikel von Willi Feldgen im Kölner Stadt-Anzeiger
Köln - Auf den Bändern rappelt es: Bis zu 60 000 Flaschen pro Stunde werden auf der am Freitag offiziell eröffneten Bierabfüllanlage gereinigt, abgefüllt und in Kästen gepackt. Fünf Millionen Euro hat die Dortmunder Brau und Brunnen AG dafür in ihre Betriebsstätte in Köln-Mülheim investiert. Damit ist aber nur der erste Baustein eines größeren Vorhabens gelegt. Bis Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres sollen weitere zehn Millionen Euro für ein neues Verwaltungsgebäude und eine Fass-Abfüllung ausgegeben werden.
Die Konzerntochter „Kölner Verbund Brauereien“ braut in Mülheim die Kölsch-Marken Gilden, Sion, Sester, Kurfürsten und Römer. Von 2004 an soll auch die Produktion von Küppers, das derzeit noch an der Alteburger Straße in der Südstadt gebraut wird, nach Mülheim verlegt werden. Verbund-Geschäftsführer Udo Hopf bezeichnet das im Kölsch-Segment ungewöhnlich breite Markenportfolio als Vorteil: „Nur so können wir den Wünschen und Erwartungen von Handel und Gastronomie und vor allem des Endverbrauchers auch hinsichtlich Geschmack und Preis optimal entgegenkommen“, sagte Hopf.
Sion als hochpreisige Premiummarke mit steigenden Ausstoßzahlen werde seit Mitte des Jahres durch klassische Werbung unterstützt und werde künftig als einzige Kölsch-Marke aus dem Unternehmen überregional und sogar deutschlandweit vertrieben, kündigte Hopf an. Gilden habe den Status einer stabilen Konsummarke, die im oberen Preisbereich dieses Segments angesiedelt sei. Im selben Segment, aber deutlich preiswerter sei Küppers. Es sei weiterhin die Marke, die bei den meisten Händlern zu finden sei. Zudem sei Küppers Marktführer im Dosenbierbereich. Kurfürsten - früher in Bonn gebraut - sei in dieser Stadt nach wie vor besonders stark. Römer wird ausschließlich bei Aldi vertrieben, und die Spezialität Kölner Wieß war vor etlichen Jahren als Abwehr gegen die hefetrüben Weizenbiere entwickelt worden.
Hopf hofft darauf, vor allem mit den Spitzenmarken Sion und Gilden, aber auch mit Sester im untersten Preissegment wachsen zu können. Bei Küppers mit stets zweistelligem Ausstoßrückgang in den zurückliegenden Jahren werde man hoffentlich im kommenden Jahr den Erosionsprozess stoppen können, sagte der Verbund-Geschäftsführer. Allerdings werde es für Küppers keine klassische Werbung (wie Plakate, Sport- und Musik-Sponsoring) mehr geben, sondern nur noch Verkaufsunterstützung im Handel.
Mit rund 740 000 Hektolitern liegt der Anteil des Kölner Verbunds am Kölsch-Markt von insgesamt 2,7 Millionen Hektolitern bei unter 30 Prozent. Das Unternehmen mit rund 240 Beschäftigten will den Ausstoß im laufenden Jahr - etwa auch durch Biermixgetränke wie „Küppers@ndCola“ - steigern.
"Dom-Brauerei spricht über einen Verkauf", Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger
"Brau und Brunnen klotzt in Köln", Artikel im Kölner Stadt-Anzeiger
Alle Marken des Kölner Verbunds kommen ab 2004 aus Mülheim. Der Getränkekonzern investiert kräftig in seine Kölner Braustätte.
In wenigen Wochen wird die Rheinisch Bergische Löwen-Brauerei in Köln-Mülheim eine neue Flaschenabfüllung einweihen. Eine weitere für das Fassbier folgt Ende des Jahres. Das Sudhaus wird 2003 erweitert. Der Mutterkonzern Brau und Brunnen in Dortmund investiert kräftig in seinen "Kölner Verbund". Ab 2004 braut der Verbund dann all seine Kölschmarken (Sion, Gilden, Kurfürsten, Sester und Küppers) in Mülheim.
Der Vertrag mit der Dom-Brauerei, die seit Anfang 2002 das Küppers-Kölsch als Lohnbrauer herstellt, läuft Ende 2003 aus, heißt es im Geschäftsbericht. Brau-und Brunnen-Chef Michael Hollmann sagte gestern am Rande der Bilanzpressekonferenz in Dortmund, er wolle Dom-Chef Jochen Köhler anbieten, dessen Kölsch künftig ebenfalls in Mülheim zu brauen. 2001 haben die Eigenmarken des Verbunds weiter an Boden verloren. Der Absatz ging um 5,1 Prozent auf nur noch 730 000 Hektoliter zurück, sagte Hollmann. Der größte Teil der Verluste entfällt erneut auf Küppers. Die kaum noch beworbene Marke verlor weitere 12,8 Prozent und kam nur noch auf gut 235 000 Hektoliter.
Die Premiuin-Marke Sion (mit einem sagenhaften Fassbieranteil von 95 Prozent) legte dagegen um 6,3 Prozent auf gut 145 000 Hektoliter zu. Gilden verlor zwar 1.9 Prozent, ist nun aber trotzdem die größte Kölsch-Marke des Verbunds. Vom gesamten Kölsch-Markt hält der Verbund 28 Prozent. "Nach Umstrukturierung und Durchsetzung der angekündigten Preiserhöhung wird der Verbund dauerhaft positive Ergebnisse erzielen", schreibt Hollmann im Geschäftsbericht. Der Getränkekonzern mit knapp 3000 Beschäftigten ist einer der drei Größten in Deutschland.
Produziert werden über sieben Millionen Hektoliter Bier (etwa mit den Marken Jever, Brinkhoffs No. 1, Berliner Pilsener, Schultheiss und Schlösser Alt) sowie 4.7 Millionen Hektoliter alkoholfreie Getränke (zum Beispiel mit Apollinaris und Sinziger). Die hohen Bankschulden wurden 2001 weiter auf 128 (Vorjahr 195) Millionen Euro abgebaut. Der zu 55 Prozent der Hypo-Vereinsbank gehörende Konzern machte 2001 einen Verlust von 31.5 (Vorjahr 54) Millionen Euro. Allerdings trug zu der Verbesserung ein Forderungsverzicht des Großaktionärs von gut 15 Millionen Euro bei. Für 2003 plant Hollmann einen zweistelligen Millionen-Gewinn.
Produktion von Giesler Kölsch eingestellt
Und damit gibt es wieder eine Traditionsmarke weniger.
Neue Kölschsorte Hansa Kölsch
Weitere Informationen im Bereich Kölschmarken -> Hansa.
Kein Päffgen Kölsch mehr in der Altstadt
Neue Hausbrauerei "Braustelle" in Ehrenfeld eröffnet
Anschrift:
Hausbrauerei Braustelle
Christianstraße 1
50825 Köln
Dom übernimmt Küppers Braustätte
Ein genialer Schachzug wenn man bedenkt, dass Dom erst vor einigen Jahren die eigene Braustätte ganz in der Nähe dichtgemacht und das Grundstück teuer an eine Immobiliengesellschaft verkauft hatte. Da es inzwischen mit Küppers immer weiter bergab ging und Brau & Brunnen wegen ständiger Verluste unter Druck stand, wahr der Zeitpunkt ideal.
Immerhin ist damit die Eigenständigkeit einer weiteren Kölschmarke gesichert.
Wer wird Sionär?
Stand 01/2002: Nach dem das Gewinnspiel zwischenzeitlich in "Sion-Kölsch Quiz" umbenannt wurde ist es mittlerweile ganz eingestellt worden. Ob es mit RTL Ärger gab oder ob es einfach zu teuer wurde ist mir nicht bekannt.
Zunft Kölsch jetzt im Internet vertreten
„Udo Hopf neuer Chef im Kölner Verbund“, Quelle: www.infodienst.de
„Der Weg zum teuren Kölsch - Marketingaufwendungen werden von Küppers auf Sion und Gilden verlagert“, Artikel im Kölner Stadtanzeiger
Wenige Braustätten für viele Marken
Der Kölsch-Markt ist im Jahr 2000 weiter um 4,5 Prozent auf 2,691 Millionen Hektoliter geschrumpft, berichtet der Kölner Brauerei-Verband. Der Rückgang fiel erneut stärker aus als im -deutschen Branchenschnitt (minus zwei Prozent), aber nicht so stark wie bei der Alt-Konkurrenz (minus acht Prozent). Der Fassbieranteil von Kölsch ist mit 53 Prozent weiter Spitze. Mit Bischofs Kölsch aus Brühl ist seit einigen Monaten eine alte Marke neu auf dem Markt. Es darf außerhalb Kölns gebraut werden, weil die Kölsch-Konvention von 1986 einigen Traditionsbetrieben im Umland Bestandsschutz garantiert. Die Konsolidierung scheint inzwischen weitgehend abgeschlossen. Die Mitglieder des Kölner Brauerei-Verbandes betreiben nur noch zwölf Kölsch-Braustätten: Zwei für die fünf Marken des "Kölner Verbundes" sowie je eine für Früh, Reissdorf, Gaffel, Richmodis, Sünner, Malzmühle, Päffgen und außerhalb der Stadt die Erzquell-Brauerei (Zunft-Kölsch) in Wiehl, Peters in Monheim so wie Bischofs in Brühl. Darüber hinaus gibt es weitere Kölsch-Marken. die als Zweit-Marken oder im Lohnbrauverfahren hergestellt werden: Dazu gehören etwa Dom, Garde, Giesler, Ganser, Rats, Römer und Severins. Außerhalb des Verbandes wird Kölsch in Hellers Brauhaus (Roonstraße) und bei Hintermeier (Frechen) hergestellt.
„Neuer Chef für Kölsch Biere“, Artikel im Kölner Stadtanzeiger
„Brau und Brunnen trennt sich von Peter Liebler“, Artikel in der Kölner Rundschau
„Kölsch : nur die großen sechs überleben (Dom, Früh, Gaffel, Gilden, Reissdorf, Sion)“, Artikel im Kölner Express
„Todesstoß für die Sester-Pferde“, Artikel im Kölner Express
„Werbung missfiel der Konkurrenz“, Artikel im Kölner Stadtanzeiger
„Ein Alt für Kölner? Düsseldorfer Brauerei startet Werbekampagne in der Domstadt“, Artikel im Kölner Stadtanzeiger
„Grenadier-Kölsch statt Äbbelwoi“, Artikel in der Kölner Rundschau
Es wird wieder Bischoff Kölsch gebraut
„Schlucken Dänen Küppers Kölsch“, Artikel von Friedemann Siering im Kölner Stadtanzeiger
Weht über den Brauereien Küppers, Gilden, Sester, Kurürsten und Sion bald die rot-weiße Fahne der dänischen Monarchie? Dem Bierkonzern Carlsberg, der nicht nur Tuborg, sondern auch Hannen-Alt besitzt, wird Interesse am kölschen Fünferpack (bekannt als "Kölner Verbund") nachgesagt. Und auch das Düsseldorfer Schlösser soll dänisch werden. Wie die "Wirtschaftswoche" berichtet, gilt Carlsberg als Favorit für die Übernahme der sechs rheinischen Biermarken, die derzeit noch dem siechenden Dortmunder Getränkekonzern Brau und Brunnen gehören. Dort muss dringend saniert werden. Aufsichtsratschef Dieter Rampl, zugleich Vorstand beim Mehrheitsaktionär Hypo-Vereinsbank, hat jetzt verkündet: Innerhalb der nächsten zwölf Monate werden wir große Teile des Konzerns abtrennen und verkaufen." Die Sanierung werde hart, "aber nur so lassen sich überhaupt Teile des Unternehmens retten", wird Rampel zitiert. In diesem Jahr müsse mit Verlusten in der Größenordnung von 60 bis 65 Millionen DM gerechnet werden. Nur noch ein Rumpfkonzern sei überlebensfähig, der dann im wesentlichen noch aus der Biermarke Jever und aus Alkoholfreiem (Apollinaris, Schweppes) bestehe, schreibt die "Wirtschaftswoche". Brinkhoff's Nr.1, Dortmunder Union, Schultheiss würden aufgegeben oder veräußert, die Alt- und Kölschmarken stünden bereits Anfang 2001 zum Verkauf. Die Hypo-Vereinsbank will indes von einer "Zerschlagung" des Konzerns nichts wissen. Rampl sei unvollständig zitiert worden, teilt eine Sprecherin mit. Es gebe lediglich als "mögliche Optionen" den Teilverkauf oder auch den Gesamtverkauf der Bankanteile an Brau und Brunnen. Der Getränkekonzern verweigerte gestern die Auskunft: "Von uns gibt es dazu keinen Kommentar." Schon seit langem wird kolportiert, dass man in Dortmund keinen Spaß am Kölsch mehr hat.
„Garde-Kölsch schließt die Brauerei“, Artikel im Kölner Stadtanzeiger
"Kölsch etabliert sich auf dem Berliner Biermarkt", Artikel in der Berliner Zeitung
Dem Beispiel folgten bald andere Kölsch-Brauer. Reissdorf geht den Weg über den Getränkehandel, während Sion (in rund 70 Kneipen) und Früh (in rund 40 Kneipen) den Weg über die Gastronomie gehen. Küppers Kölsch ist ebenfalls schon länger als Flaschenbier erhältlich.
"Töchter zum Erfolg verdammt", Artikel von Willi Feldgen im Kölner Stadt-Anzeiger
Rainer Verstynen, der Vorstandsvorsitzende von Brau und Brunnen, bestätigte auf der Bilanzpresskonferenz ebenfalls das schon länger kursierende Gerücht, das die Dom-Brauerei vom Jahr 2001 an ihr Bier bei Küppers brauen lässt.
Insgesamt gab es bei Brau und Brunnen 1999 statt der erwarteten Gewinne wieder mal einen Verlust zu verzeichnen, diesmal von 50,5 Millionen DM. Da die Bayerische Hypo- und Vereinsbank mit 55% der Anteile Hauptaktionär ist, und gerade Banken nicht dafür bekannt sind Verlustbringer durchzuschleppen, gibt es zur Zeit ernsthafte Gespräche über den Verkauf von Brau und Brunnen (an Paulaner ???).